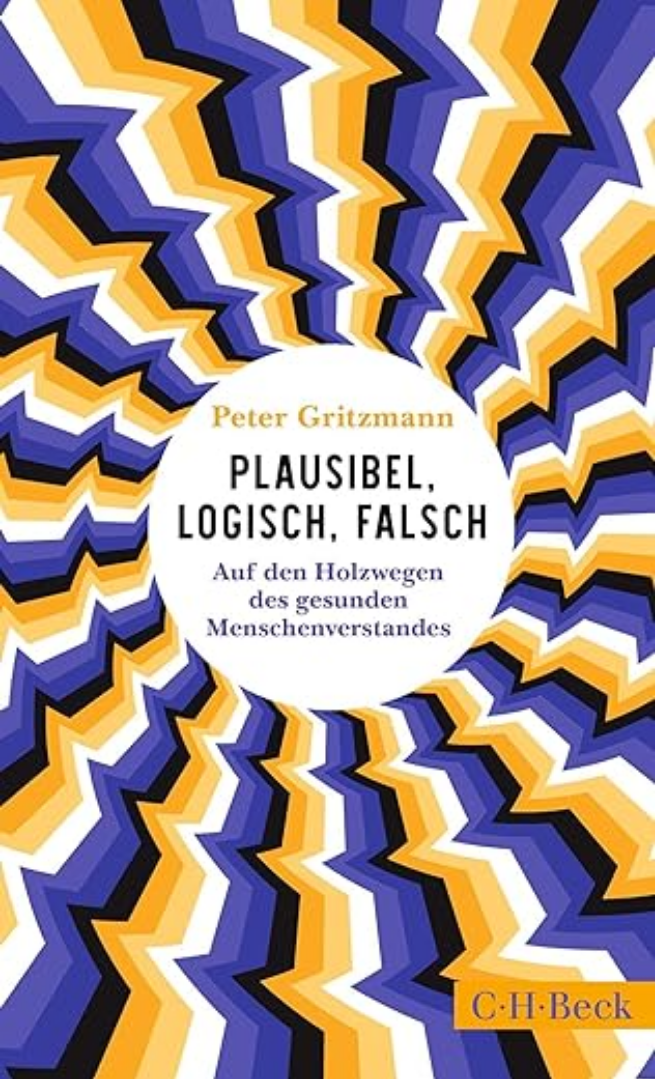 Gritzmann, Peter
Gritzmann, Peter
C.H.Beck; 1. Edition (15. Februar 2024); 217 Seiten; 22 €
ISBN-10: 3406814255
ISBN-13: 978-3406814259
„Manipulation überall. … Davon handelt dieses Buch jedoch nur am Rande. Vielmehr befasst es sich mit den Überforderungen durch scheinbar logische und richtige Schlüsse, die bei genauerer Betrachtung aber keineswegs logisch und richtig sind.“ So formuliert der Verfasser, seit 2020 pensionierter Mathematik-Professor in München, zu Beginn seines Vorwortes. Kann man mit solchen doch sicher wenigen Ausnahmen – so denke ich – ein Buch füllen? Man kann, wie Gritzmann in über 20 Kapiteln aufzeigt.
Bei einem regelmäßigen Gesundheitscheck lassen Sie auch einen Früherkennungstest auf eine seltene Krankheit durchführen. Der Test hat eine 99-prozentige Sicherheit, liefert also nur in einem Prozent aller Fälle ein falsch positives Ergebnis. Sie erhalten ein positives Ergebnis. Müssen Sie jetzt das Schlimmste befürchten? Wie der Verfasser Ihnen zeigt, können Sie ganz beruhigt sein: weil die Krankheit sehr selten ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie wirklich erkrankt sind, sehr gering – trotz der hohen Treffsicherheit des Testes.
Wahlen gibt es in verschiedenen Varianten, als Verhältnis- oder Mehrheitswahl, wie sie beide in Deutschland vorkommen. Eine absolute Mehrheitswahl mit Stichwahl gibt es bei der Präsidentenwahl in Frankreich. Eine Punktewahl gibt es beispielsweise beim European Song Contest. Wie die Auswahl des Wahlsystems den sogenannten „Wählerwillen“ beeinflusst, zeigt der Verfasser zum einen an konstruierten Konstellationen, an denen die Unterschiede besonders deutlich werden, aber auch an der realen deutschen und amerikanischen Situation. Die Problematik einer Abstimmung in einem Bürgerentscheid etwa über den Bau eines Flughafens oder Windparks wird klar, wenn zu entscheiden ist, wer daran teilnehmen darf: je nach Entfernung des umstrittenen Objekts wird die Ablehnung oder Zustimmung unterschiedlich sein. So kann also die Auswahl der möglichen Wahlberechtigten das Ergebnis des Entscheids beeinflussen.
Nicht fehlen dürfen natürlich Paradoxien, also scheinbar sich widersprechende Aussagen, die aber tatsächlich wahr sind. Das Braess-Paradoxon ist ein beliebtes Beispiel. Worum handelt es sich dabei? Ist es möglich, dass der Bau einer zusätzlichen Straße, die den Verkehrsfluss verbessern soll, diesen dann sogar verschlechtert? Dass das tatsächlich der Fall sein kann, beschreibt der Verfasser ausführlich an erfundenen und realen Beispielen.
Dass mit der unterschiedlichen Bildung von Durchschnittswerten, die rechnerisch völlig korrekt sind, aber doch manipulativ Interpretationen hervorgerufen werden können, ist ein weit verbreitetes Phänomen: zum Beispiel kann eine Firma wahrheitsgemäß behaupten, dass der Durchschnittspreis ihrer Ware in allen Kategorien gesunken ist. Dabei haben sich die einzelnen Preise gar nicht verändert, allein durch Wechsel einer Ware von einer zur anderen Kategorie ist der Effekt erreicht worden. Auch hier steckt ein Paradoxon dahinter, das Will-Rogers-Phänomen. Dieses „kann aber auch zu potentiell lebensbedrohlichen Fehlentscheidungen führen“, wie medizinische Studien zeigen. „Statistisch verbessern sich somit die Lebenserwartungen beider Gruppen einfach nur, weil die Krankheit früher erkannt wird.“ Daher müssen solche Effekte beachtet und vermieden werden.
Schindluder kann man auch treiben mit Veränderungsraten, gezeigt hier an Inflationsraten in Deutschland. Eine Aussage wie „… verlangsamte sich die Abnahme des Wachstums der Staatsverschuldung“ ist selbst für den kritischen Bürger schwer verständlich und wird hier (ohne mathematische Fachsprache: der Begriff der „Ableitung“ wird nicht benutzt) analysiert.
„Denn so, wie es typische optische Täuschungen gibt, gibt es auch logische, auf die wir nur zu leicht hereinfallen. Diesen wollen wir auf den Grund gehen.“ Das macht der Verfasser an weiteren Themen in lockerer, teils amüsanter und stets überzeugender Weise verständlich. Vielleicht hilft uns das, manche Denkfehler künftig zu vermeiden – aber wir sollten nicht zu sicher sein, denn „Der gesunde Menschenverstand ist weit beschränkter und weit anfälliger für Täuschungen, als uns bewusst und sicherlich als uns lieb ist.“ Wer daher noch gründlicher vorgehen will, findet in den Anmerkungen weitere Literatur und Internetadressen.
Rezension: Hartmut Weber (Kassel)


