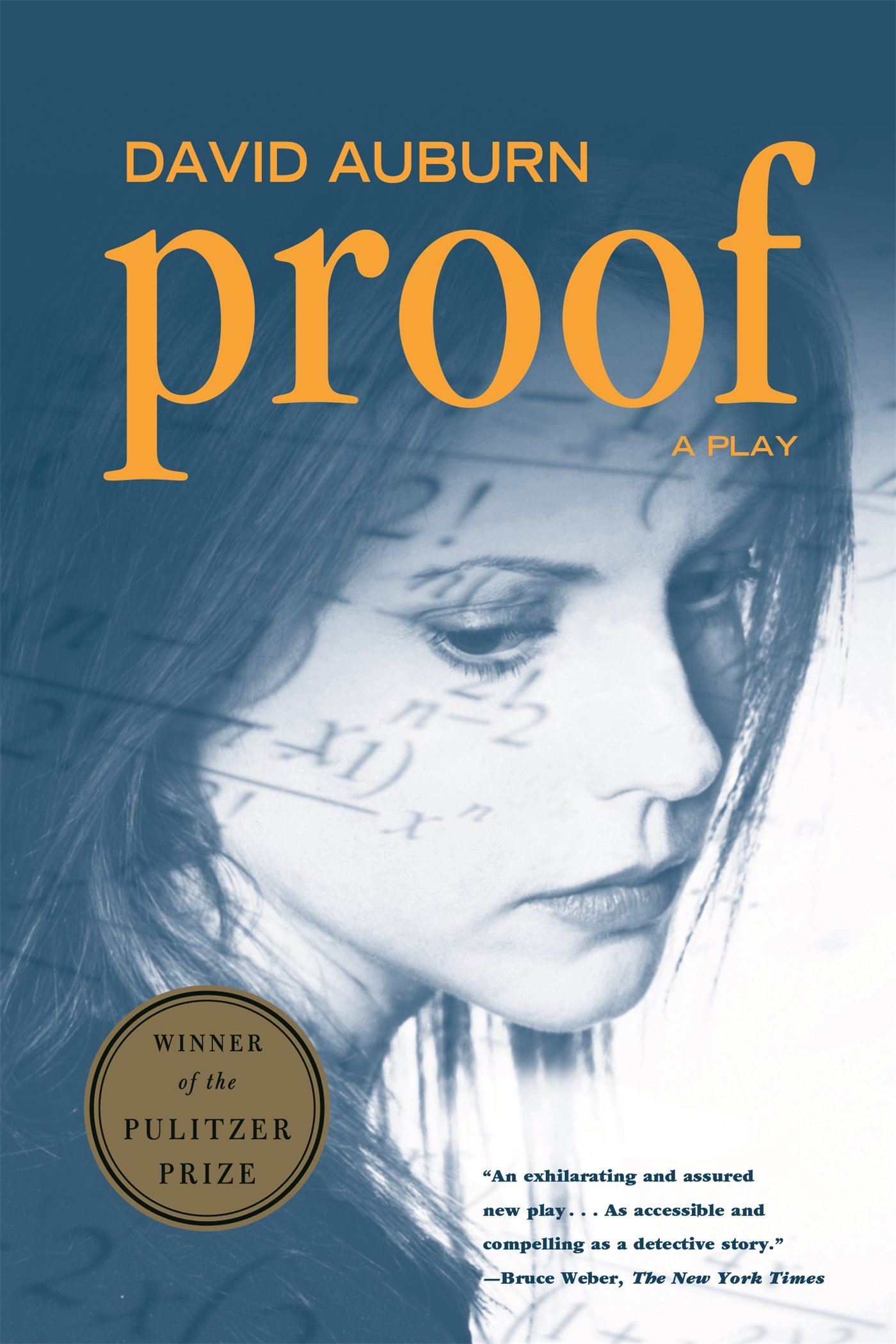
Proof - Der Beweis
David Auburn
Theaterstück (dt. Uraufführung in den Hamburger Kammerspielen)
Eine sehenswerte deutsche Urauffuhrung an den Hamburger Kammerspielen
"Eigentlich geht es nicht um Mathematik in meinem Stück" sagt David Auburn im Interview. Doch so ganz Recht hat er nicht: immerhin geht es durchaus ums Beweisen, um mathematische Aktivität. Und es geht allemal um Mathematiker. Von diesem und diesen zeichnet er auch dem mathematisch nicht vorbelasteten Zuschauer ein Bild - in groben Strichen, aber von ein paar kleineren Schnitzern abgesehen nicht unzutreffend. Das Vierpersonenstuck beginnt eher langweilig laut als hintergrundig faszinierend - und plätschert dann bis zur Pause so vor sich hin. Wer gleich zu a Beginn große erkenntnistheoretische Würfe erwartet hatte, wird sicher zunächst enttäuscht sein: der Uralt-Topos "Genie" und Wahnsinn" etwa wird in den Raum gestellt aber nicht interessant oder neu beleuchtet; vom Wesen der Mathematik gibt es außer etwas Zahlenakrobatik und einer netten Logelei nichts Bemerkenswertes; Verhalten im Spannungsfeld zwischen Wissenschaftlichkeit, praktischem Leben und menschlicher Beziehung ist Thema, aber nicht mehr.
Interessant jedoch sind bereits vor der Pause die Charakterzeichnungen. (Zuweilen muss man sich diese durch Ruckubersetzung ins amerikanische Idiom selbst erschließen: Auburn formuliert knapp und treffend, den nicht ausgesprochenen Hintergrund - wie etwa kulturell definierte Erwartungen der Charaktere aneinander - stets mit verwendend. Da geht einiges in der sprachlichen und kulturellen Verpflanzung verloren, zumal nicht alle Darsteller mit diesem Hintergrund ihrer Zeilen stets vertraut zu sein scheinen.) Alle vier Charaktere, der zum Zeitpunkt der Haupthandlung gerade gestorbene ehemals geniale Professor, seine beiden Töchter und ein Doktorand, sind Mathematiker in irgendeinem Sinne. Die mit Abstand echteste unter ihnen, die den in seinen letzten Jahren verwirrten Vater pflegende Tochter Catherine, zeigt in ihrem Verhalten auch die klarsten "mathematischen Tugenden": nur sie ist zu jedem Zeitpunkt unverlogen und absolut authentisch, und nur sie spricht stets - gerade auch in emotionalen Fragen - direkt den Kern der Dinge an.
Klischeevorstellungen von Mathematikern finden sich - fur einige Zuschauer vielleicht paradoxerweise, fur uns wohltuend - noch am ehesten im Verhalten ihrer am wenigsten mathematischen Schwester Claire, einer New Yorker Währungsanalystin. ("Ich kann schnell mit großen Zahlen rechnen; das genügt.", "Diese drei Informationen reichen mir.") Claire hat sich die Welt zurechtgelegt, in der sie sich bewegt; Interesse an der wahren Welt - einschließlich ihres mathematischen Teils - kennzeichnet Catherine. Und Sarkasmus. Wie Catherine zuweilen ihre gestylte Schwester trocken auflaufen lässt, ist ein Genuss für den mathematisch wachen Zuschauer, egal ob er nun Mathematiker ist oder nicht: lange vor Claire merkt er, wie Catherine deren small talk nur als Spiegel mitspielt - und wenn Claire es schließlich auch merkt, zwinkert ihr politisch doch so korrektes Baby uns schon längst aus der Tiefe des Brunnens zu.
Auch zu dem Klischee, alle Genies - und dazu gehören ja bekanntermaßen alle Mathematiker - seien mehr oder minder verrückt oder zumindest nicht lebenstüchtig, leistet Auburn Aufklärungsarbeit. Von den vier auftretenden Mathematikern sind nur zwei - allerdings die beiden echten, Catherine und ihr Vater - offenkundig oder zumindest scheinbar lebensuntüchtig. Von den anderen beiden ist Claire geradezu furchterregend lebenstüchtig, der ewige Doktorand Hal andererseits ein sympathisch-unspektakulärer und überhaupt nicht verrückter wissenschaftlicher Mit-Arbeiter. Auch so etwas gibt es also - eine Erkenntnis, die manchem im Publikum die Realität unserer Zunft ein wenig näher bringen dürfte.
Und das Besondere unserer Zunft? Auch hier versucht sich das Stück. Wie der englische Titel durch das Fehlen des Artikels bereits andeutet, geht es nur vordergründig um einen konkreten mathematischen Beweis. Letztlich geht es ums Beweisen schlechthin; insbesondere um die Frage, wann man sich denn eines Beweises sicher sein kann. So tritt denn neben dem - notgedrungen stets im Hintergrund bleibenden - großen mathematischen Beweis ein kriminologischer Beweisversuch des praktischen Lebens, der dem Zuschauer durchaus dramatisch nahegebracht wird. (Dramatik ubrigens ist bei Auburn eigenartig konzipiert. Es gibt in der zweiten Hälfte reichlich davon, doch wird sie nie so aufgebaut, dass der Zuschauer sie erahnend erleiden könnte: sie wird ihm in Form unangekündigter Wechselbäder verabreicht, die zwar durchaus clever sind, aber aufgrund mangelnder Vorbereitung weder erlösend noch erschütternd; fur die mir im Hinausgehen hörbaren Mitzuschauer waren sie wohl eher verwirrend.) Diese groß angelegte Metapher stößt jedoch bald an Grenzen, die vermutlich nur demjenigen gleich klar sind, der beide Arten von Beweis aus eigener Anschauung kennt. Das ist schade: ob wir es wollen oder nicht, der greifbarere kriminologische Beweisversuch wird so manchem Zuschauer als Bild fur den ihm nicht direkt zugänglichen mathematischen Beweis stehenbleiben. Und mogen einige seiner Paradigmata noch als Parallele durchgehen (wie "letzte Sicherheit gibt es nie"), so bricht die a Analogie spätestens bei der menschlichen Dimension des praktischen Beweisversuchs zusammen: dessen unvermittelt und kategorisch geäußerte Quintessenz ("Du hättest mir gleich vertrauen sollen"), so billig sie zunächst als Moralintröpfchen inmitten aller kriminologischer Verfahrenstechnik wirkt, ist hier die wirklich zentrale Aussage - und sie hat eben kein Pendant in der Mathematik.
Zum Topos Genie und Wahnsinn gibt es im Zusammenhang mit der Frage, wann denn ein Beweis ein Beweis sei, noch eine überraschende entzaubernde Wendung, die mich an ein ähnliches eigenes Erlebnis erinnert und entsprechend bewegt hat. Hier hätte die Suche bzw. Aufklärung weitergehen können: wenn die im Volksmund sprichwörtliche Unfehlbarkeit eines mathematischen Beweises ("ist einfach logisch") zusammenschmilzt auf ein subjektives Sicherheitsgefuhl der beteiligten Mathematiker (allenfalls noch mit einer Prise im Wissenschaftsbetrieb institutionalisierter Sicherheitsvorkehrungen wie unabhängiger Verifikation durch verschiedene Arbeitsgruppen), wie verlässlich ist dann dieses Sicherheitsgefuhl? Ist es es nicht, weshalb konvergiert dann die Wahrheitsfindung im mathematischen Wissenschaftsprozess doch meist so schnell und offenbar nachhaltig? Kann unsere Suche nach Wahrheit - oder nach Einigung - im praktischen Leben oder im politischen Alltag hiervon etwas lernen, ohne dass wir dadurch gleich handlungsunfähig wurden?
(Rezension: Reinhard Diestel, erschienen in den "Mitteilungen der DMV")


