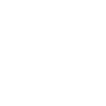Seit Januar 2017 unterrichtet David Muschke Mathematik in der Klasse 8.3 der Refik-Veseli-Schule, einer Sekundarschule im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Mathematik studiert hat der 29-jährige gebürtige Dresdner im zweiten Anlauf, sein Entschluss Lehrer zu werden, musste erst reifen. Eine Reife, die seinen Schüler*innen zugute kommt. Denn ihnen will er nicht nur Mathematik beibringen, sondern vor allem zu Erfolgserlebnissen verhelfen.
Seit Januar 2017 unterrichtet David Muschke Mathematik in der Klasse 8.3 der Refik-Veseli-Schule, einer Sekundarschule im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Mathematik studiert hat der 29-jährige gebürtige Dresdner im zweiten Anlauf, sein Entschluss Lehrer zu werden, musste erst reifen. Eine Reife, die seinen Schüler*innen zugute kommt. Denn ihnen will er nicht nur Mathematik beibringen, sondern vor allem zu Erfolgserlebnissen verhelfen.
Herr Muschke, wie kam es dazu, dass Sie von einer aussichtsreichen Karriere in einem großen Verlag ausgerechnet auf den Beruf des Mathematiklehrers umgeschwenkt sind?
Dreieinhalb Jahre Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule und begleitend eine Art Traineeprogramm in verschiedenen Verlagsbereichen, hauptsächlich in Hamburg, mit Auslandssemester in Spanien und Hospitation in London – das war für mich eine spannende Ausbildung. Ich habe aber auch gemerkt, dass mich diese Arbeit langfristig nicht so erfüllt. Deshalb habe ich schon gegen Ende des Studiums überlegt, mich beruflich umzuorientieren.
Gab es einen Auslöser für diesen Sinneswandel?
Nicht direkt. Der Lehrerberuf hat irgendwie immer schon in mir gesteckt. Als Jugendlicher hatte ich zum Beispiel die Angewohnheit, für mich selbst Tests zu entwickeln, wenn ich mich auf Klassenarbeiten vorbereitet habe. Während meines ersten Studiums in Hamburg habe ich dann einen Lehrer kennengelernt, der ein sehr guter Freund geworden ist und als Lehrer auch ein Vorbild. Er hat an einer Gesamtschule im Hamburger Vorort Allermöhe unterrichtet, wo ich später auch ein freiwilliges Praktikum absolviert habe. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, was eine gute Schule ausmacht und was das Lehrersein bedeutet. In dieser Zeit habe ich mich für das Lehramtsstudium entschieden.
Und warum für Mathematik als Fach?
Das hat mit meinen eigenen Erfahrungen als Schüler zu tun. An der Schule bekommt man ja oft mit, dass Mathematik angeblich nur etwas für die Schlauen ist; dass Mathe schwierig ist, dass man viel üben und vielleicht auch ein gewisses Talent mitbringen muss.
Nach dem Motto: Mathematik kann nicht jeder.
Ja, genau. Ich selbst hatte in der Schule zwar immer sehr gute Noten, mir ist Mathematik also leichter gefallen als den meisten anderen. Später an der Universität habe ich aber gemerkt, dass ich nicht so schnell lerne wie die Mathe-Überflieger. Ich brauchte mehr Lernzeit und weniger abstrakte Erklärungen. Insofern war das Fach eine große Herausforderung für mich. Wie man Mathematik für Schüler zugänglich machen kann, das hat mich schon immer interessiert. Während der Schulzeit habe ich meinen Mitschülern Nachhilfe gegeben. Und die sagten manchmal zu mir: Jetzt habe ich das zum ersten Mal kapiert! Das war nicht nur für sie, sondern auch für mich ein großes Erfolgserlebnis. Und diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass Mathematik eigentlich für jeden und jede machbar ist und dass Jugendliche ihre Angst vor Mathematik verlieren, wenn sie ein Erfolgserlebnis haben.
Bei Ihrem zweiten Fach Geschichte treibt Sie etwas anderes an?
Ja. Ich bin ein historisch und politisch sehr interessierter Mensch. Geschichte ist eher ein Hobby. Ich lese viel auf diesem Gebiet und diskutiere auch gerne.
Von 2011 bis 2016 haben Sie das Lehramtsstudium an der Freien Universität Berlin absolviert. Welchen Anteil hatte das Fach Mathematik?
An der FU Berlin waren für den Bachelor insgesamt 180 Leistungspunkte erforderlich, davon entfiel die Hälfte auf mein erstes Fach Mathematik, weitere 60 auf Geschichte, die restlichen 30 auf die jeweilige Fachdidaktik sowie erziehungswissenschaftliche Module. Die „regulären“ Mathematik-Studenten müssen nur 30 Leistungspunkte mehr erreichen. Im Bachelor ist also der Anteil der Fachwissenschaft für die Lehramtsstudenten relativ hoch. Im Master ist es genau anders herum. Da gibt es mehr fachdidaktische Module und mehr Lehrveranstaltungen zu Themen wie Lernmotivation, Lerndiagnostik oder Unterrichtsgestaltung.
Kürzlich ist die Debatte darüber, ob das Lehramtsstudium nicht zu fachwissenschaftlich ausgerichtet ist und zu wenig pädagogische, psychologische oder methodische Kompetenzen vermittelt, wieder hochgekocht. Letztes Jahr hatten angehende Grundschulpädagogen an der FU Berlin gegen die Prüfungsaufgaben im Modul Mathematik protestiert, nachdem fast 40 Prozent durch die Prüfung gefallen waren. Wie haben Sie das im Studium erlebt?
Diese Debatte wird nicht nur für das Fach Mathematik, sondern eigentlich in fast allen Fächern geführt. Ich persönlich habe das Mathematik-Studium als überaus anregend empfunden. Die fachwissenschaftlichen Kenntnisse, die ich in den Vorlesungen und Seminaren gewonnen habe, werde ich zwar kaum in der Schule anwenden können, aber das finde ich nicht tragisch. Denn erstens war das für mein Selbstwertgefühl eine tolle Sache, dass ich das durchgestanden habe. Zweitens habe ich mich sehr intensiv mit Themen befasst, mit denen ich sonst vielleicht nie in Berührung gekommen wäre.
Welche Themen waren das?
Ich könnte jetzt fast alle Gebiete nennen, denn der Stoff setzt ja dort an, wo das Schulfach Mathematik endet. Aber Algebra und die Zahlentheorie sind hier besonders treffende Beispiele. Zwar bietet auch die Zahlentheorie ein paar Anknüpfungspunkte an reale Gegebenheiten, aber im Grunde sind das innermathematische Gebiete. Ich habe mich in meiner Bachelor-Arbeit mit verschiedenen Beweisverfahren im Zusammenhang mit Primzahlen beschäftigt und war fasziniert von der mathematischen Struktur, die sich auf diesem Gebiet entwickelt hat. Auch wenn ich das im Schulunterricht nicht unmittelbar nutzen kann, hat das für mich einen Mehrwert. Ich habe gelernt, dass Mathematik nicht statisch ist, sondern ein dynamisches Forschungsfeld. Und ich glaube außerdem, dass man den Schülerinnen und Schülern eher Begeisterung für das Fach vermitteln kann, wenn man selbst tief eingestiegen ist und eine Vorstellung davon hat, wohin sich Mathematik entwickeln könnte.
Aber gibt es nicht auch eine gewisse Arroganz der Fachwissenschaft gegenüber denjenigen, die nicht „Voll- Mathematiker“ sind, sondern Mathematik auf Lehramt studieren?
Man bekommt an der Uni schon mit, dass die Lehramtsstudenten als „halbe Mathematiker“ gelten. Das hat aus meiner Sicht aber auch eine gewisse Berechtigung; in dem Sinne, dass viele der Lehramtsstudenten direkt von der Schule an die Uni kommen und dann das Studium mit möglichst wenig Aufwand schaffen wollen, um wieder zurück an die Schule zu gehen. Das heißt, das was die Universität bietet, das nehmen einige gar nicht wahr. Wenn man sich aber für ein Mathematikstudium entscheidet, ohne damit die Berufsperspektive Lehrer zu verbinden, dann weiß man noch gar nicht genau, in welchem Beruf man später arbeitet. Das allein bewirkt schon eine viel tiefere Auseinandersetzung mit dem Fach als das bei vielen Lehramtsstudenten der Fall ist. Deswegen kann ich diese möglicherweise leicht abwertende Haltung gegenüber den Kommilitonen durchaus nachvollziehen.
Seit einem guten halben Jahr unterrichten Sie als Referendar an einer Sekundarschule in Berlin, mitten in Kreuzberg. Die Refik-Veseli-Schule – sie ist nach einem Albaner benannt, der einer jüdischen Familie während des ZweitenWeltkriegs das Leben rettete – galt bis vor einigen Jahren als Problemfall: hohe Fehlzeiten bei den Schülern, frustrierte Lehrer, hohe Durchfallquoten bei den Schulabschlüssen. Mittlerweile hat die Schule die Kehrtwende geschafft. Was ist für Sie das Besondere an der Schule, was zeichnet die Schüler*innen aus?
Es ist eine Schule im Wandel. Die Quote der Schulabgänger ohne Abschluss hat sich reduziert. Die Schulleitung treibt viele neue Projekte voran. Was die Schule auch ausmacht, ist, dass man versucht, wirklich jede Schülerin und jeden Schüler mitzunehmen und jeder und jedem den bestmöglichen Abschluss und die bestmögliche Schulerfahrung zu verschaffen. Das sorgt für eine wertschätzende Haltung den Schülern gegenüber und das honorieren die Schüler auch. Ich will die Probleme, die die Schule nach wie vor hat, nicht kleinreden. Der Unterricht ist weit entfernt davon optimal zu sein. Aber man muss bedenken, dass unsere Schüler oftmals gegenüber der Schule als Einrichtung nicht sehr offen eingestellt sind, weil sie 67 Foto: Christoph Eyrich Mohamed Magdi Osman mit einem Lego-Roboter in der Mathematik-AG der Refik-Veseli-Schule in Berlin-Kreuzberg früher Rückschläge und Frustrationen erlebt haben. Und dadurch, dass der Anteil der Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache über 90 Prozent beträgt, sollte man auch die Sprachbarriere nicht unterschätzen. Aber: Dadurch dass die Schüler merken, dass man sie wertschätzt, ihnen Vertrauen schenkt und auch Freiraum für selbstgesteuertes Lernen gibt, erhöht sich ihre Selbstwirksamkeit. Und das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung.
Inwiefern läuft der Unterricht anders ab als an einem Gymnasium, wo es vielleicht eine homogenere Schülerschaft gibt?
Meine Schüler nehmen kein Blatt vor den Mund. Sie sind sehr authentisch, im Positiven wie im Negativen. Das gefällt mir. Nach der letzten Stunde kam eine Schülerin ganz stolz zu mir und meinte, sie hätte jetzt zum ersten Mal etwas in Mathematik verstanden und sie sei ganz glücklich. Man merkte ihr an, wie wichtig so ein Erlebnis ist. Auf der anderen Seite haben sich meine Schüler beschwert, der Unterricht sei nicht abwechslungsreich genug. Sie meinten auch, ich könne nicht einfach zum nächsten Thema übergehen, wenn die Hälfte der Klasse den Stoff noch nicht verstanden hat. Wir haben das alle gemeinsam mit der Schul-Sozialarbeiterin besprochen. Das wäre mir vielleicht an einer anderen Schule so nicht passiert. Mir hat das gezeigt, dass ich anders an den Unterricht herangehen muss, dass ich mein Programm hier nicht so knallhart durchziehen kann, sondern stärker auf die einzelnen Schüler eingehen muss.
 Mohamed Magdi Osman mit einem Lego-Roboter in der Mathematik-AG der Refik-Veseli-Schule in Berlin-Kreuzberg
Mohamed Magdi Osman mit einem Lego-Roboter in der Mathematik-AG der Refik-Veseli-Schule in Berlin-Kreuzberg
Wie machen Sie das?
Ich habe gelernt, die Aufgaben an das individuelle Lernniveau anzupassen. Am Anfang habe ich noch nicht so viel differenziert und die Erfahrung gemacht, dass die Schüler nach fünf Minuten unruhig wurden. Die einen sind aufgestanden, die anderen haben gequatscht. Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass einige wenige Schüler unterfordert, andere überfordert waren. Meine Schüler suchen sich, wenn sie nicht weiterkommen, eben einfach etwas Spannenderes. Ihre Frustrationstoleranz ist relativ gering. Man muss sich bei jeder Aufgabe sehr genau überlegen, welches Vorwissen, welche Techniken benötigt werden. Und man muss Hilfestellungen vorbereiten, um den Schülern über die einzelnen Hürden, die Aufgaben bereithalten, hinüberzuhelfen.
Was sie von sich selbst berichtet haben, dass es Sie in der Schule und später auch im Studium motiviert hat, 68 die Herausforderung Mathematik zu bewältigen, genau das fällt Ihren Schülern offenbar schwer. Bei Misserfolgen gelingt es ihnen nicht, sich selbst zu motivieren und dranzubleiben. Da sind sie auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Genau.
Inwiefern hat der didaktische Teil des Studiums Sie auf solche Situationen vorbereitet?
Es gab ein paar Lehrveranstaltungen, von denen ich ganz besonders profitiert habe. Im Seminar „Didaktik des Stochastik-, Geometrie-, Arithmetik- und Algebraunterrichts“ beispielsweise sind wir ganz konkret auf mögliche Fehlvorstellungen von Schülern bei der Bruchrechnung oder bei der Einführung negativer Zahlen eingegangen.
Sie meinen Konzepte, die Schüler*innen im Kopf haben, die sie aber auf eine falsche Fährte führen?
Ja, Schüler haben oft Prä-Konzepte im Kopf, die sie aus ihrem Alltag heraus entwickeln oder aus mathematischen Gebieten, die vorher behandelt wurden. Sie wenden diese dann auf ein neues Gebiet an und das kann dann zu Fehlvorstellungen führen. Für Mathematiklehrer ist es ganz wichtig, sich mit diesen Fehlvorstellungen vertraut zu machen. Man verliert ja als Experte sehr leicht den Blick dafür, was Novizen möglicherweise sehen oder nicht sehen. Das Seminar hat dafür gute Anreize geliefert, aber ich hätte mir das noch viel ausführlicher gewünscht.
Kommen wir auf Ihren Arbeitsalltag zu sprechen. Neben dem Unterrichten, was sind typische Aufgaben?
Ich muss zum Beispiel eine kontinuierliche Dokumentation der Schülerleistungen anfertigen. Noten sind für viele Schüler, vor allem für die mit schwachen Leistungen, eher demotivierend. Deshalb versuche ich, die Noten mit verbalen Beurteilungen zu unterfüttern. In der Regel bekommen Schüler diese Beurteilungen, wenn ich Lernerfolgskontrollen, Tests oder Klassenarbeiten zurückgebe. Ich habe aber auch schon einmal einfach jedem Schüler etwas Nettes aufgeschrieben. Da steht dann zum Beispiel: Ich finde es toll, dass du in den letzten Wochen das und das geschafft hast, dich in dem und dem Bereich verbessert hast. Hinzu kommt die Vorbereitung der Unterrichtsstunden, und auch die Elternarbeit ist sehr wichtig. Nach einem Unterrichtstag kann es vorkommen, dass ich fünfzehn Eltern hintereinander anrufe, weil auch mal fünfzehn meiner einundzwanzig Schüler die Berichtigung der Klassenarbeit oder die Unterschrift der Eltern nicht dabei haben. Wenn sich das wiederholt, lade ich die Eltern zu einem Gespräch in die Schule ein. Zweimal im Halbjahr gibt es außerdem Schüler-Eltern-Lehrer Feedback- Gespräche, an denen ich als Fachlehrer teilnehmen kann. Und wenn ich als Fachlehrer nicht dabei bin, dann muss ich den Klassenlehrern Feedback zu den Schülern geben. Ich bin außerdem ins Jahrgangsteam eingebunden, das sind die Klassenlehrer und einige Fachlehrer, die in den 8. Klassen unterrichten. Wir treffen uns alle zwei Wochen zu einer Sitzung und sprechen über einzelne Vorfälle, was unsere Schüler angeht, oder über die Förderpläne für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.
Gibt es Aufgaben, die sie besonders gerne erledigen?
Ja. Unheimlich gerne verliere ich mich in der Gestaltung von Lernmaterialien. Ich könnte meinen Schülern einfach ein Schulbuch hinlegen und sagen: Bitte S. 127 aufschlagen und Aufgaben 7a bis f rechnen. Aber ich merke oft, dass diese Materialien nicht gut zu meiner Lerngruppe passen. Entweder fehlt einigen Schülern das Vorwissen oder wir haben im Unterricht andere Bezeichnungen verwendet. Irgendetwas passt immer nicht. Dann überlege ich mir, wie ich das besser machen kann. Es kann sein, dass ich zwei Comicfiguren zeichne, die sich darüber unterhalten, wie man eine bestimmte Aufgabe lösen kann. Das heißt, ich nehme mögliche Denkprozesse, die in den Köpfen meiner Schülern vorgehen könnten, vorweg, verschriftliche sie und versuche, das als Comic umzusetzen. Oder ich habe Material und entwickle dazu Hilfekarten. Darauf finden die Schüler dann Hinweise wie: Wenn du an dieser Stelle nicht weiterkommst, dann schau’ hier nach. Oder ich habe bereits Lernmaterial und entwickle für meine starken Schüler eine vertiefende Aufgabenstellung, damit sie einen zusätzlichen Anreiz haben.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben Sie für beides Leidenschaft: für die Mathematik genauso wie für ihre Vermittlung.
Ich würde sagen vor allem fürs Vermitteln von Mathematik. Aber durchaus auch für die Mathematik selbst. Diese Leidenschaft für Mathematik hat sich durch das Studium verstärkt. Früher dachte ich, Mathematik sei etwas Nützliches für den Alltag. Rechnen eben. Durch das Studium habe ich Mathematik stärker als Problemlösen und Erkennen von Strukturen kennengelernt. Und für das Problemlösen brauche ich eben nicht nur Techniken wie Rechnen, sondern auch Problemlösetechniken, heuristische Strategien, Kreativität – und vor allen Dingen Ausdauer. Alles Kompetenzen, die man aus meiner Sicht gut als Heranwachsender gebrauchen kann. Und deswegen glaube ich, dass Mathematik auch ein Weg für Schüler sein kann, Selbstwirksamkeit zu erfahren, also zu erleben, dass ich etwas, was ich als schwierig wahrnehme, tatsächlich aus mir selbst heraus lerne zu bewältigen.
Mathematik als Persönlichkeitsbildung.
Ja.
Was sollte jemand mitbringen, der Mathematiklehrer werden will?
Erst mal Leidenschaft fürs Fach. Auf jeden Fall aber auch den Wunsch, sich mit Kindern und Jugendlichen zu beschäftigen. Man muss zugewandt sein, und dazu gehört für mich viel Geduld. In dieser Hinsicht kämpfe ich auch oft mit mir selbst. Man braucht auch einen gewissen Pragmatismus. Denn man kann nicht davon ausgehen, junge Menschen innerhalb von kurzer Zeit verändern zu können. Lehrer haben einen gewissen Einfluss, aber den sollte man nicht überschätzen. Also: Geduld, Pragmatismus, Leidenschaft fürs Fach, Zugewandtheit, vor allem in Bezug auf junge Menschen – das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Dinge. Aber sicherlich auch die Fähigkeit zur Teamarbeit. Wenn ich meine Arbeit gut machen will, dann muss ich mich andauernd mit anderen Menschen austauschen, mit Eltern, mit Kollegen. Man muss sich im Team organisieren können, verlässlich sein und konsequent sein in dem, was man tut.
 Berkan Kara, Jamen Shamma und Mert Furkan (v. l. n r.) mit David Muschke, Mathematik-AG der Refik-Veseli-Schule in Berlin-Kreuzberg
Berkan Kara, Jamen Shamma und Mert Furkan (v. l. n r.) mit David Muschke, Mathematik-AG der Refik-Veseli-Schule in Berlin-Kreuzberg
Zum Schluss noch eine Frage: Was wollen Sie Ihren Schüler*innen über die Mathematik hinaus mitgeben?
Mut und Zuversicht. Auch wenn die Ergebnisse meiner Schüler in Mathematik vielleicht nicht immer die besten sind, sage ich ihnen: Kopf hoch, Noten sind nicht alles. Ihr habt das Privileg einer kostenlosen Bildung. Versucht, das so gut wie möglich zu nutzen. Ich möchte meinen Schülern auf jeden Fall vermitteln, dass es bei Bildung nicht nur darum geht, Kompetenzen zu erwerben, die sich irgendwann verwerten lassen. Es geht auch darum Bildung als Kulturleistung zu verstehen, die darin besteht, sich vertieft mit etwas auseinandersetzen und daraus ein Erfolgserlebnis für sich selbst zu ziehen und ein besseres Selbstwertgefühl zu entwickeln. Ich möchte gerne einen positiven Blick auf Bildung weitergeben. Das Beste, was ich erreichen kann, ist, dass meine Schüler gerne in die Schule kommen.
Herr Muschke, ich danke Ihnen für das Gespräch!
Kristina Vaillant ist freie Journalistin in Berlin und arbeitet regelmäßig für das Medienbüro der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. Fotos von Christoph Eyrich.