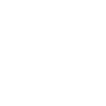Nach zehn Jahren in der Forschung entschied die Mathematikerin Julia Ehrt, ihr Engagement für die Rechte von transgeschlechtlichen Menschen zum Beruf zu machen. Heute ist sie Programmdirektorin bei ILGA, einem bei den Vereinten Nationen akkreditierten Dachverband, der sich weltweit für die Menschenrechte von Schwulen und Lesben, von bisexuellen, intersexuellen und transgeschlechtlichen Personen einsetzt. Der Abschied von der wissenschaftlichen Karriere fiel Julia Ehrt nicht allzu schwer – auch weil sie in ihrem neuen Beruf vieles fortführt, was sie als Mathematikerin ausmacht.
 Julia Ehrt. Foto: Christoph Eyrich
Julia Ehrt. Foto: Christoph Eyrich
Frau Ehrt, Sie haben Mathematik und Physik auf Lehramt studiert und dann mit der Promotion in Mathematik eine wissenschaftliche Karriere angestrebt, warum?
Für mich war schon früh klar, dass, wenn ich irgendwann mal studiere, es vermutlich Mathematik und Physik sein werden. Ich hatte immer schon eine gewisse Affinität zu Zahlen. Als kleines Kind habe ich immer gezählt, irgendwann auch mal bis 10 000, das ging über Stunden. In der Schule hatte ich Mathe-Leistungskurs und dann habe ich Physik und Mathematik auf Lehramt studiert. Erst während des Studiums in Berlin habe ich gemerkt, dass mir Mathematik eigentlich mehr liegt und daher noch eine Promotion draufgesattelt.
Sie wollten in die Forschung?
Ich wollte gerne an der Uni bleiben. Nicht nur weil mir Mathematik sehr viel Spaß gemacht hat, das hatte noch andere Gründe. Mir ist klargeworden, dass man als Lehrer* in schlussendlich in einer Behörde arbeitet. 2006, als ich mich zwischen Lehramt und Promotion entscheiden musste, gab es in Berlin den großen Skandal um die Rütli-Schule. Lehrer hatten einen offenen Protestbrief geschrieben. Aber wenn man in einer Behörde arbeitet, geht das eigentlich nicht, weil der Dienstweg einzuhalten ist. Ich habe mich gefragt: Kann ich mit dieser Einschränkung leben? Damals war ich schon jahrelang im Verein TransInterQueer aktiv und als Aktivist*in fällt es einem schwer, nichts zu unternehmen, wenn man Missstände beobachtet. Außerdem hatte ich kurz vorher mein Coming-out und damit stellte sich auch die Frage, ob ich als Transfrau in einer Berliner Schule unterrichten will.
Womit haben Sie sich in Ihrer Promotion beschäftigt?
Mit partiellen Differenzialgleichungen. Ich habe auf dem Feld Dynamische Systeme promoviert und mir folgendes, recht theoretisches Problem angeschaut: Wenn man eine parabolische Gleichung hat, die unter anderem chemische Reaktionen von Flüssigkeiten beschreibt, und der zentrale Parameter in dieser Gleichung die Viskosität ist, was passiert dann eigentlich, wenn die Viskosität sehr klein wird. Ich habe den Grenzwert gegen 0 angeschaut. Das ist deswegen interessant, weil sich, wenn man die Viskosität bei 0 ansetzt, die Art der Gleichung ändert. Die ist dann nicht mehr parabolisch, sondern hyperbolisch und hat grundlegend andere Lösungsstrukturen. Daraus ergab sich die grundlegende Frage: Konvergieren die Lösungen für die parabolische Gleichung, wenn man die Viskosität gegen 0 laufen lässt gegen die Lösung der hyperbolischen Gleichung? Und die Antwort lautet allgemeinverständlich ausgedrückt: Sie tun es, aber eben nicht immer. Es gibt Spezialfälle, in denen sie es nicht tun.
Sie haben fast zehn Jahre in Berlin geforscht, zunächst an der Freien Universität, dann amWeierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik und schließlich an der Humboldt-Universität.Wie hat sich die Arbeit dort mit ihrem politischen Engagement vertragen?
An der Uni war das eigentlich nie ein Problem. Die Mathematik ist ein Feld auf dem Dinge, die andere Menschen als ungewöhnlich wahrnehmen, eher toleriert werden. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sich Mathematiker*innen mit sehr abstrakten Dingen beschäftigten, die wiederum die meisten Menschen als ungewöhnlich empfinden [lacht]. Deswegen habe ich als Wissenschaftlerin und auch als Lehrende mit meinen Studierenden nie große Schwierigkeiten gehabt. Allerdings weiß ich natürlich nicht, was geredet wurde, wenn ich den Raum verlassen habe. Tratsch hat es mit hundertprozentiger Sicherheit gegeben, aber den habe ich geflissentlich ignoriert.
Wie war ihr Coming-out an der Uni?
So ein Coming-out ist ja ein Prozess, für einen selbst wie auch für die Menschen, die einen umgeben. Ich hatte über die Semesterferien beschlossen, dass ich ab dem Sommersemester, ich meine es war 2003, meinen neuen Namen nun auch im Arbeitskontext verwenden würde. Als Tutorin an der Freien Universität habe ich damals Übungen zur Vorlesung meines künftigen Doktorvaters betreut und ihm wollte ich das eigentlich als Erstes mitteilen. Aber er war so beschäftigt, ich habe ihn einfach nicht angetroffen. Der schrieb dann bei der ersten Vorlesung meinen alten Namen an die Tafel und in dem Moment, so hat er es mir später erzählt, gab es ein Kichern im Raum. Irgendwann sagte einer der Studierenden: Die heißt Julia. Das werde ich nie vergessen. Später saßen wir dann in seinem Büro und er fragte mich: Wie heißen Sie denn nun? Damit war das gegessen. Aber andere Transleute, auch an der Uni, können sicher andere Geschichten erzählen. Für manche meiner Freundinnen und Freunde war das nicht so schön und so einfach.
Seit wann sind Sie hauptberuflich Aktivistin?
Bis 2011 habe ich hauptberuflich als Wissenschaftlerin gearbeitet und dann habe ich meinen damaligen Chef an der Humboldt-Uni gebeten, halbtags arbeiten zu dürfen, weil ich für Transgender Europe, den Dachverband der Trans-Organisationen in Europa, den ich mitgegründet habe, die Geschäftsführung übernehmen wollte. Das kam allen Beteiligten gelegen, denn ich hatte eine Kollegin, deren Stelle auslief und die konnte die zweite Hälfte übernehmen. Mir war aber klar, dass das der Ausstieg aus der Wissenschaft ist. 2013 habe ich dann entschieden, Vollzeit als Aktivistin zu arbeiten.
War der Abschied schwer?
Nein, das war gar nicht so schwer, denn realistisch betrachtet, wäre ich wahrscheinlich nie Professorin geworden. Das Feld der Dynamischen Systeme, auf dem ich geforscht habe, wird in Deutschland selten bearbeitet. Außerdem dachte ich mir, es gibt so wenige Leute im Trans- Aktivismus, die diese Arbeit machen können, und auf der anderen Seite so viele Leute, die Mathematik machen können wie ich es kann.
Sie haben sich als Mathematikerin eher ersetzbar gefühlt denn als Aktivistin.
Ja genau.
Seit 2019 sind Sie bei der International Gay, Lesbian, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) in Genf tätig.Was sind ihre Aufgaben als Programmdirektorin?
ILGA World ist ein Dachverband, der 1600 Mitglieder in über 150 Staaten hat. Das sind alles LSBTIOrganisationen, also Organisationen, die zu den Themen schwul, lesbisch, trans, bi- oder intersexuell arbeiten. Wir haben sechs Unterorganisationen, die Asien, Ozeanien, Afrika, Europa, Nordamerika sowie Lateinamerika und die Karibik repräsentieren. Unser Büro in Genf bildet die Klammer, wir sind für die Arbeit auf globaler Ebene zuständig, und meine Rolle ist es, die inhaltliche Arbeit zu koordinieren. Die Menschenrechtsprozesse innerhalb der Vereinten Nationen funktionieren normalerweise so, dass Nationalstaaten hinsichtlich der Umsetzung und Einhaltung der Menschenrechte evaluiert werden, und wir bringen dann die Menschenrechtsaktivist*innen aus diesen Ländern nach Genf zu den Vereinten Nationen, um mit ihnen dort zu arbeiten. Das ist ein großer Teil unserer Arbeit. Darüber hinaus erfassen wir die weltweite Rechtslage zum Thema „Sexuelle Orientierung“. Um dies in den 193 UN-Mitgliedsstaaten zu untersuchen und zu bewerten, haben wir drei Kategorien entwickelt: Kriminalisierung, Anerkennung und Schutz. Bei Kriminalisierung geht es um die Kriminalisierung von einvernehmlichen gleichgeschlechtlichen Handlungen. Das ist im Moment in 70 Ländern der Fall. Bei der Kategorie Schutz geht es um die Frage, welche Länder eigentlich vor Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung schützen. Und beim dritten Block geht es um die Ehe für alle oder um eingetragene Partnerschaften oder die Frage der Adoption. Wir geben regelmäßig einen Report1 heraus, der diese Ergebnisse zusammenfasst.
Gibt es ein Anliegen, das momentan ganz oben auf der politischen Agenda steht?
Der Schutz vor Gewalt steht weit oben auf der Agenda, auch die Entkriminalisierung von einvernehmlichen gleichgeschlechtlichen sexuellen Handlungen. Natürlich gibt es auch verschiedene Trends in unterschiedlichen Weltregionen. Was sich in den letzten zehn Jahren geändert hat, betrifft den ganzen Themenbereich Trans. Innerhalb der letzten zehn Jahre haben sich die Transmenschen emanzipiert und gesagt, wir haben auch Rechte und die werden nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von der Bewegung ignoriert. Wir haben uns einen Raum erkämpft. Und das schlägt sich in einer wesentlich umfassenderen Arbeit zu dem Thema nieder. Das andere große Thema ist Intergeschlechtlichkeit beziehungsweise Diskriminierung und Gewalt aufgrund der Geschlechtsmerkmale.
Das müssen Sie erklären.
Bei den Geschlechtsmerkmalen gibt es welche, die werden männlich zugeordnet, es gibt welche, die werden der Eigenschaft weiblich zugeordnet und es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen – sie werden gemeinhin als intersexuelle oder intergeschlechtliche Menschen bezeichnet –, bei denen lassen sich diese körperlichen Merkmale eben nicht einem einzigen Geschlecht zuordnen.
Die werden dann als nicht-binär bezeichnet.
Nein und ja. Intergeschlechtliche Menschen können sich als Männer, Frauen oder nicht-binär identifizieren. Rechtlich ist das in Deutschland sehr interessant, denn seit Anfang 2019 gibt es neben „männlich“ und „weiblich“ einen dritten Geschlechtseintrag „divers“. Das geht auf die Klage einer nicht-binären intergeschlechtlichen Person zurück, die gesagt hat, es gibt im deutschen Recht keinen Geschlechtseintrag, mit dem ich mich positiv identifizieren kann, ich brauche einen Geschlechtseintrag, der weder männlich noch weiblich ist. Diese Person hat das bis zum Verfassungsgericht durchgeklagt und das hat ihr Recht gegeben.2 Ich glaube das Urteil wird international Rechtsgeschichte schreiben. Es ist ein schönes Urteil, weil es mit ganz wenig Rechtsgrundlage auskommt. Im Kern sagt das Urteil Folgendes: Man muss gegenwärtig einen Geschlechtseintrag haben und im Moment gibt es nur zwei positive Möglichkeiten. Weil aber Geschlecht in der Verfassung in Artikel 3 geschützt ist, ist diese Regelung diskriminierend, das muss geändert werden. Und das Großartige für mich als internationale Aktivistin ist, dass es diese Zutaten in einem Großteil aller Staaten der Erde gibt: Den Schutz vor der Diskriminierung des Geschlechts und dass von den meisten Menschen ein Geschlechtseintrag verlangt wird.
Das heißt, die Regelung lässt sich auf andere Länder übertragen.
Theoretisch ja, aber es braucht natürlich auch eine gewisse Rechtstradition und politischen Willen. Dieses Gesetz ist jedenfalls eines der großen Themen.
Die Gesetzgebung in Deutschland hat Vorbildcharakter, trotzdem haben trans- und intergeschlechtliche Menschen im Alltag auch zu kämpfen, was sind die größten Schwierigkeiten?
Transgeschlechtliche und intergeschlechtliche Menschen haben unter Diskriminierung, Gewalt, Stigmatisierung, Exotisierung und unter der Ausgrenzung von gesellschaftlichen Prozessen zu leiden – das sind die Kernschwierigkeiten.
Können Sie das konkretisieren? Ich habe in einer Zeitungsmeldung gelesen, dass viele arbeitslos sind.
Ja, die Arbeitslosigkeit ist unter Transmenschen, die als solche äußerlich erkennbar sind, ganz bestimmt sehr hoch. Es ist nicht ganz einfach, Daten zu finden – das gilt für trans- und intergeschlechtliche Menschen. Neben der Ausgrenzung ist auch die Gewalterfahrung im öffentlichen wie im privaten Raum, sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa riesig. Transgender Europe hat 2010 angefangen, Morde an Transmenschen zu erfassen, inzwischen wurden weltweit fast 3000 Morde gezählt, über 100 davon in Europa. Diese Menschen wurden schlicht und einfach ermordet, weil sie trans sind. Verbale und physische Gewalt auf der Straße sind verbreitet. Ich erlebe das auch -– nicht jeden Tag, vielleicht auch nicht jeden Monat, aber immer wieder. Wenn man bestimmte geschlechtliche Erwartungen im eigenen Geschlechtsausdruck nicht erfüllt, führt das auch dazu, dass man überall angestarrt wird. Und weil das dauernd passiert, ist das für viele ganz schwer auszuhalten. Denn dadurch wird die eigene und nach außen sichtbare geschlechtliche Identität Tag für Tag in Frage gestellt und abgesprochen. Auch die Rechtslage ist in Deutschland noch unzureichend, wenn es um die Änderung des Geschlechtseintrags und des Namens geht. Für trans- und intergeschlechtliche Menschen gibt es jetzt offiziell unterschiedliche Regelungen. Das macht natürlich keinen Sinn, ist aber so. Nach dem sogenannten Transsexuellen-Gesetz, müssen Transmenschen die Änderung des Geschlechtseintrags und des Namens bei Gericht beantragen, das bestellt dann zwei Gutachter, die je ein psychologisches Gutachten anfertigen. Das kostet die Antragsteller viel Geld. Als ich mein Trans-Comingout hatte, musste man sogar noch Unfruchtbarkeit nachweisen, um das Geschlecht zu ändern. Und wenn man nicht dauerhaft unfruchtbar war, dann musste man sich sterilisieren lassen – eine der gravierendsten Menschenrechtsverletzungen. Das wurde 2011 geändert, ebenfalls ausgelöst durch ein Urteil des Verfassungsgerichts. Ich habe erst seit September letzten Jahres einen Pass und einen Personalausweis, in dem Julia Ehrt steht. Vorher stand da ein männlicher Name und der Geschlechtseintrag war männlich. Das Ding musste ich 15 Jahre lang vorlegen, obwohl alle wussten und sahen, dass ich trans bin.
Gibt es Länder, die in dieser Hinsicht weiter sind als Deutschland?
Ja. 2012 hat Argentinien ein Gesetz verabschiedet, das erste Gesetz auf der Welt, das Transmenschen ein Recht auf ihre Identität einräumt. Als Konsequenz kann man Namen und Geschlechtseintrag auf Antrag ändern. Ohne Voraussetzung. Man geht einfach aufs Amt und sagt, ich möchte meinen Geschlechtseintrag und meinen Namen ändern. Das ist alles. Das war bahnbrechend, das ist eingeschlagen wie eine Bombe und hat dazu geführt, dass sich in Europa ein viel stärkeres Bewusstsein dafür entwickelt hat, dass man hier etwas unternehmen muss.
Die Inhalte, mit denen sie sich befassen sind gänzlich andere als die, die sie alsWissenschaftlerin umgetrieben haben. Gibt es trotzdem Kontinuitäten?
Ja, total. Ich arbeite bei ILGA mit vier Juristinnen zusammen, und tatsächlich unterscheidet sich die Art und Weise, wie Jurist*innen denken und wie Mathematiker*innen denken, nicht so sehr. Das liegt, glaube ich, daran, dass sowohl die Rechtswissenschaft als auch die Mathematik einen Satz von Regeln definiert und dann versucht herauszufinden, was sich aus diesen Regeln ableiten lässt. In der Mathematik sind es unsere Axiome und die Grundannahmen, die wir aufstellen, in der Rechtswissenschaft sind es eben die Gesetze. Jetzt ist das Vorgehen in der Mathematik rigider, der Wortlaut des Gesetzes ist dagegen nicht stringent, er lässt sich interpretieren. Aber die Art und Weise zu denken ist sehr, sehr ähnlich und das macht die Arbeit für mich einfacher. Der andere Aspekt ist, dass man, wenn man Mathematik studiert und lange Mathematik gemacht hat, trainiert ist, zu analysieren, was der Kern eines Problems ist. Wir lernen, ein mathematisches Problem nicht nur von unterschiedlichen Seiten zu betrachten, sondern es auch zu sezieren, um den Kern des Problems zu erkennen. Und diese hoch analytische Art zu denken und an Probleme heranzugehen, hilft einem tatsächlich in allen möglichen Lebenssituationen, aber insbesondere auch bei komplexen politischen Prozessen. Wenn wir beispielsweise ein Gesetz ändern wollen, dann müssen wir analysieren, was das eigentliche Problem ist, welche Fragen zu stellen sind, wo die Hindernisse liegen und was die richtigen Stellschrauben sind.
Gibt es noch andere Parallelen?
Ja. Denn auch die Mathematik ist global. Ob ich mit einem/r Wissenschaftler*in aus Japan spreche oder aus Südafrika oder aus Europa, die Mathematik ist überall die gleiche. Global ist Mathematik auch, weil es eine hoch spezialisierte Wissenschaft ist. Je länger man das macht, desto kleiner wird der Kreis von Leuten, mit denen man sich noch fachlich austauschen kann. Unsere Arbeitsgruppe am Weierstraß-Institut war besetzt mit Kollegen aus vielen unterschiedlichen Ländern. Viele kamen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, aus Russland, aus Georgien, der Ukraine, Litauen und dann gehörten noch zwei Westeuropäer dazu, eine davon eine Transfrau. Da erwartet man irrsinnige Spannungen, aber die gab es nicht. Wir sind alle zusammen zum Mittagessen gegangen, wir haben über deren gemeinsame Geschichte in der Sowjetunion gesprochen, uns über politische Fragen ausgetauscht, auch über Rechte von Transmenschen. Und meine Arbeit jetzt ist auch global vernetzt. Die Fähigkeit, über kulturelle Grenzen hinweg mit Leuten zusammenzuarbeiten, die habe ich aus diesen Erfahrungen als Mathematikerin mitgenommen.
Anmerkungen
1. ilga.org/state-sponsored-homophobia-report
2. tinyurl.com/yd8bbbay
Das Gespräch führte Kristina Vaillant,
freie Journalistin in Berlin.
www.vaillant-texte.de