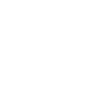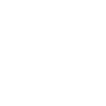Als engagierter Tutor ging Jonas Röhrig gerne auf die Verständnisprobleme von jüngeren Studierenden ein und entdeckte so sein Interesse für den Bildungsbereich. Nach Abschluss seines Mathematikstudiums an der Universität Bonn fand er eine Stelle im Verlagswesen bei der Westermann-Gruppe in Köln. Deren bekanntestes Produkt, den Diercke Weltatlas, dürfte jeder schon mal in der Hand gehalten haben. Als Programmmanager ist Jonas Röhrig zuständig für die Betreuung und strategische Entwicklung des Verlagsprogramms in Mathematik und Naturwissenschaften. Im engen Austausch mit Autorenteams plant er Schulbücher und schätzt die Herausforderung, dass es hier kein klares Richtig oder Falsch wie im Mathematikstudium gibt.
 Jonas Röhrig. Foto: Privat
Jonas Röhrig. Foto: Privat
Du kommst gerade von der Arbeit. Wie war Dein Arbeitstag heute?
Es war nicht unbedingt der typische Arbeitstag, denn wir hatten heute Morgen eine größere Schulung, in der wir uns mit dem Thema KI auseinandergesetzt haben. Als Programmmanager bin ich zum Beispiel dafür zuständig, dass ich Inhalte, die bei uns reinkommen, einer ersten Prüfung unterziehe und dann an die Redaktion weiterleite, die diese veröffentlichungsfertig macht. Das war auch heute der Fall. Darüber hinaus gab es einiges an Tagesgeschäft, also kleinere Dinge zu verschiedenen Projekten, die bei mir parallel laufen.
Was sind das für Inhalte, die bei Dir reinkommen?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Das Klassische sind Manuskripte für Schulbücher oder Arbeitshefte, die ich darauf prüfe, dass sie den vereinbarten Kriterien entsprechen. Dazu gehören zum Beispiel der Umfang, die Konzeption im Sinne des grundsätzlichen Aufbaus, das Technische und wie es umgesetzt ist, also ob es für unsere weitere Bearbeitung verständlich ist und, ob es inhaltlich unseren Anforderungen genügt. Die Inhalte sind meist mathematisch, weil ich hauptsächlich die Mathematikbetreue. Heute waren es digitale Materialien, die ich überprüft und an die Redaktion weitergegeben habe. Dass zusätzlich zu den Schulbüchern digitale Materialien angeboten werden, hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Je nach Projekt sind diese relativ vielfältig. Das können verschiedene Word-Dokumente wie Arbeitsblätter, Klausurvorschläge oder Hinweise für Lehrkräfte für die Arbeit mit dem Buch im Unterricht sein oder Excel-Vorlagen für spezielle Aufgaben, die man mit digitaler Mathematiksoftware wie GeoGebra bearbeiten kann, oder auch Videos.
Für welche Schulformen sind diese Medien?
Ich bin im Bereich Mathe und Naturwissenschaften für die berufliche Bildung zuständig und da bedienen wir alles von der Berufsschule über die Berufsfachschule bis hin
zum beruflichen Gymnasium.
Inwiefern unterscheiden sich die Lehrmaterialien dieser Schulformen von denen für allgemeinbildende Gymnasien?
Das ist schwer pauschal zu beantworten, weil in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen gelten und es auch vom Niveau des Bildungsabschlusses abhängig ist. Grundsätzlich sollte aber eine deutlich höhere Ausrichtung an den zukünftigen Berufsalltag gegeben sein. In einigen Schulformen machen die Schüler nebenbei ein Praktikum, wo sie zwei Tage die Woche sind und woran man berufsbezogene Inhalte konkret festmachen kann. Aber das funktioniert im Bereich Mathematik sicherlich
nicht immer. Bei Vollzeitschulformen, in NRW beispielsweise eine höhere Berufsfachschule oder das berufliche Gymnasium, gibt es eine Unterteilung in verschiedene Fachbereiche, die sich die Schüler vorher aussuchen. Entsprechend gibt es dann pro Fachbereich typische Berufssituationen, auf die man eingehen kann und an denen man sich in den Szenarien, die man im Matheunterricht untersucht, ausrichtet.
Als Programmmanager schreibst Du nicht selbst an Lehrbüchern. Wer sind die Autoren der Lehrmaterialien, die bei euch eingereicht werden?
Im Normalfall sind das Personen, die direkt aus der Praxis kommen, also Lehrkräfte an den entsprechenden Schulformen. Eine Lehrkraft kennt die Situation an der Schule und die Schülerinnen und Schüler genau und erfasst deren Schwierigkeiten beziehungsweise Punkte, die sie besonders motivieren. Wir denken, dass sie darauf aufbauend besonders gutes Unterrichtsmaterial in Form von einem Schulbuch schreiben kann. Die Manuskripte kommen also immer von extern, werden im Austausch von Redaktion, Lektorat und Autoren diskutiert und überarbeitet und wir flicken vielleicht an ein oder zwei Stellen mal kleine Löcher.
Mit was beschäftigst Du Dich außerdem in Deinem Beruf?
Ich befasse mich zum Beispiel auch mit der Markt- und Wettbewerbsanalyse und der strategischen Entwicklung des Verlagsprogramms. Grundsätzlich ist es ja so, dass es verschiedene Verlage gibt, die Produkte wie Schulbücher anbieten. Für uns ist dann die Fragestellung, wie wir unsere Produkte so gestalten können, dass wir möglichst viele
davon verkaufen. Ein wichtiger Punkt dafür ist erstmal, was der aktuelle Status an den Schulen ist. Das ist relativ schwierig herauszufinden, weil es keine allgemeinen Daten dazu gibt. Keine Schule ist dazu verpflichtet, irgendwo zentral anzugeben, welche Schulbücher sie gerade benutzt und in welchem Umfang. Außerdem werden die meisten
Exemplare über den Buchhandel als Zwischenhändler verkauft, sodass wir keine Informationen über die tatsächlichen Kunden haben. Das bedeutet, man ist auf einzelne
Gespräche angewiesen. Dafür haben wir ein Team von Schulberatern, die in den Schulen unterwegs sind und vor Ort Gespräche führen. Das ist die vielleicht größte Informationsquelle, um Rückmeldungen zu bekommen, gerade auch, was ein inhaltliches Feedback angeht. Selbst auf einer höheren Ebene, wenn es zum Beispiel darum geht, wie
viele Bücher wir in einem Bundesland verkaufen, sind das immer noch wichtige Rückmeldungen. Natürlich gibt es Tools, anhand derer man das grob einschätzen kann, aber tatsächlich lässt sich über diese Einzelgespräche vor Ort am besten herauszufinden, wie viel und was von Wettbewerbern oder von uns genutzt wird und warum.
Gehst Du auch selbst in die Schulen?
Teilweise. Grundsätzlich ist die Idee, dass das punktuell gerade in größeren Fokusprojekten gemacht wird. Während der Corona-Jahre war es aber natürlich schwierig,
noch jemanden von außerhalb an die Schule zu lassen. Und generell liegt der Hauptteil schon beim Team der Schulberater.
Du meintest ja, heute sei nicht so ein typischer Arbeitstag gewesen. Wie würde so einer aussehen?
Primär die zweistündige Veranstaltung am Anfang war untypisch. Ansonsten ist es schon relativ typisch, dass ich mich mit Inhalten von Autoren auseinandersetze und dafür entweder mit ihnen im Gespräch oder im E-Mail-Austausch bin. Es kommen auch regelmäßig inhaltliche Kundenanfragen bei mir rein. Das sind meistens Kleinigkeiten, die man zwischendurch erledigen muss, die sich aber natürlich summieren können. Größer sind sicherlich Punkte, welche Projekte ich weiter plane, üblicherweise für eine bestimmte Schulform in einem speziellen Bundesland. Wie sinnvoll ist es, dort ein bestimmtes Produkt anzubieten? In welchem Rahmen ist das für uns wirtschaftlich interessant? Inwiefern ist es umsetzbar? Das sind Dinge, mit denen ich mich in größeren Blöcken in der Woche immer mal wieder beschäftige. Einen typischen Tagesablauf habe ich eigentlich nicht, jeder Tag ist unterschiedlich.
Was sind Höhepunkte bei Deiner Arbeit? Hast Du eine Lieblingsbeschäftigung?
Besonders schön ist, wenn ich beispielsweise an einem Buch mitgewirkt habe, das am Ende von vielen Schülern genutzt wird und zu dem wir positive Rückmeldungen bekommen. Das ist natürlich die Idealsituation und das mitzubekommen sind sehr schöne Phasen. Was mir als Tätigkeit vielleicht am besten gefällt, ist, mit Autoren über die Inhalte und deren Umsetzung zu sprechen, über mögliche Ideen, sowohl mathematischer als auch konzeptioneller Natur. Was kann man digital machen? Was kann man im Print anbieten? Wie lässt sich das vielleicht verknüpfen? Diese konstruktiven Austauschgespräche machen mir viel Spaß und sind vielleicht der wichtigste Grund, warum ich das gerne mache.
Gibt es ein Projekt oder ein Buch, auf das Du besonders stolz bist?
Es gibt eine größere Projektarbeit, in der es darum ging, inwiefern wir eine komplett neue Konzeption mit an den Markt bringen können. Diese lief über einen relativ langen Zeitraum von drei Jahren und ich war von Anfang an für die strategische Entwicklung verantwortlich. Das fing an mit dem Gedanken, was überhaupt interessant ist
und wie man Produkte für das Marktsegment erfolgreich ausrichtet. In Tagungen mit möglichen Autoren haben wir erstmal komplett bei Null angefangen und erarbeitet, was
überhaupt Ideen und Zielsetzungen sind. Das Projekt hat dadurch einen sehr langen Prozess über viele Schleifen durchlaufen, wo wir immer neue Ideen eingebracht haben, darüber diskutiert haben und dann schlussendlich zu einem fertigen Buch gekommen sind. Das halte ich besonders gerne in den Händen und in dieses Projekt ist von meiner Seite aus bisher am meisten Zeit und Energie eingeflossen.
Was ist das für ein Buch und für ein Konzept?
Das Konzept zielt darauf ab, gerade Schüler in der beruflichen Bildung möglichst gut abzuholen und sie zu motivieren, sich überhaupt mit mathematischen Themen auseinanderzusetzen. In diesen Schulformen gibt es viele Schüler, die schlechte Vorerfahrungen gemacht haben, bei denen Wissensrückstände immer größer geworden sind
und die vielleicht Angst vor Mathematik haben, weil sie ständig etwas „falsch“ machen können. Das kann sehr undankbar sein. Deshalb ist ein wichtiger Punkt, sie überhaupt erstmal dazu zu bewegen, etwas zu machen. Das heißt, wir versuchen, mit etwas Niedrigschwelligem einzusteigen, das man einfach mal ausprobieren kann und wo es noch gar nicht darum geht, ob eine Beobachtung oder Überlegung richtig oder falsch ist. Das kann zum Beispiel eine Aufgabe sein, bei der man erstmal haptisch oder digital interaktiv etwas machen oder beobachten soll. Darauf aufbauend wird dann versucht, in typische Berufs- oder Alltagssituationen reinzukommen und zu zeigen, dass Mathematik in diesen Situationen hilft, zu Lösungen zu kommen. So soll die Notwendigkeit von Mathematik aufgezeigt werden. Erst dann kommt der theoretische Anteil, denn letztendlich soll ja auch die Theorie der Mathematik vermittelt werden. Das Konzept haben wir für die Fachoberschulen in Hessen entwickelt, als dort neue Lehrpläne in Kraft getreten sind. Das ist typischerweise ein Zeitpunkt, zu dem neue Schulbücher angeschafft werden, die dann über Jahre genutzt werden. Von solchen Anschaffungszyklen sind wir als Verlag relativ stark beeinflusst.
Was empfindest Du als besondere Herausforderungen in Deinem Beruf?
Im Mathestudium konnte ich immer genau sagen oder mindestens verstehen, ob etwas richtig oder falsch und somit gut oder schlecht ist. Dann in eine Situation zu kommen, in der es viele Unsicherheiten und Meinungen gibt und man trotzdem Entscheidungen treffen muss, die für hunderte von Schulen gut sein sollen, ist mir gerade am Anfang schwer gefallen. Man kommt natürlich nach und nach besser rein, entwickelt Erfahrungswerte und ein Gefühl dafür, wie ernst man gewisse Vorlieben, Meinungen oder Empfehlungen unterschiedlicher Stellen nehmen muss. Aber das ist für mich eine deutlich größere Herausforderung gewesen als vieles andere. Gewissermaßen war es aber eine bewusste Entscheidung, nach dem Studium in einen Bereich zu gehen, in dem ich mich mehr mit Menschen austauschen und auch mit subjektiven Argumenten beschäftigen muss und in dem man nicht so leicht sagen kann, dass das eine richtig und das andere falsch ist, also einen Gegenpol zum rein theoretischen Mathestudium zu haben.
Wie verlief Dein Weg über das Mathestudium in Deinen aktuellen Beruf?
Das Mathestudium war erstmal ein logischer nächster Schritt nach der Schule, der mir relativ früh klar war. Meine Gedanken waren, dass mir das grundsätzlich Spaß macht, dass ich es schon gut hinbekommen werde, dass ein Abschluss in Mathematik grundsätzlich positiv besetzt ist und ich dann immer noch gucken kann, was ich damit machen möchte. Ich hatte also keinen festen Plan und mir war auch bewusst, dass von den mathematischen Inhalten vieles später für mich nicht mehr relevant sein würde. Das Ende des Studiums kam dann gewissermaßen plötzlich. Natürlich war es absehbar, aber ich habe in den fünf Jahren Studium den Gedanken, was ich danach machen möchte, eher vor mir hergeschoben. Ich habe mir nach Abgabe der Masterarbeit dann ein paar Monate Zeit genommen, in denen ich noch weiter tutoriert und ein paar Nebenveranstaltungen an der Uni besucht habe und mich damit auseinandersetzen konnte, in welche Richtung ich beruflich gehen möchte. Aus meinem Umfeld haben einige Kommilitonen bei Banken, Versicherungen
oder Beratungen angefangen, aber das hat mich zum damaligen Zeitpunkt nicht so angesprochen. Ich habe im Mathestudium relativ viel tutoriert und es hat mir gut gefallen, auf Schwierigkeiten von jüngeren Studierenden einzugehen. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich es ganz gut geschafft habe, auf meine Gegenüber einzugehen und bei möglichen Verständnisproblemen zu helfen. Dass ich auf das Bildungswesen gekommen bin, war also mehr ein Nebenprodukt des Studiums. Ich bin schließlich zufällig über die Stelle bei der Westermann-Gruppe gestolpert und habe gedacht: Das passt eigentlich ganz gut.
War es für diese Stelle ausschlaggebend, in welchem Bereich der Mathematik Du Dich im Studium spezialisiert hattest?
Da ich mich inhaltlich in meinem Beruf nur mit dem Stoff bis zum Abitur beschäftige, also mit den Themen, die wir in Büchern abdecken, ist meine Spezialisierung nicht relevant gewesen. Ich war im Studium mit Fokus auf Topologie und Algebra sehr theoretisch unterwegs. Natürlich kommt es mir aber zugute, dass ich die Inhalte bis zum Abitur gut verinnerlicht habe.
Die Universität Bonn, an der Du studiert hast, gilt als eine der besten für Mathematik in Deutschland. Hast Du Dich deswegen für das Studium dort entschieden?
Es war durchaus ein Faktor. Ich habe nach gewissen Kriterien geguckt, welche Unis im Bereich Mathematik einen guten Ruf haben, und da ist Bonn, gerade was die Reine
Mathematik angeht, sehr weit vorn. Ich habe zu Schulzeiten an Mathematik-Olympiaden teilgenommen und bei den Teilnehmern dort war Bonn auch sehr beliebt. Außerdem hat mir Bonn als Stadt gut gefallen.
Hast Du einen Tipp an Mathematikstudierende, die sich für die Arbeit im Verlagswesen interessieren?
Wir haben recht verschiedene Jobs. Ich hatte vorhin schon mal angesprochen, dass wir eine gewisse Unterteilung in das Programmmanagement, in dem ich arbeite, und die
Redaktion haben. Die Redaktion arbeitet deutlich näher an den konkreten Inhalten. Wenn man sich mehr mit allgemeinen Strategien und Strukturen auseinandersetzen möchte, dann ist das Programmmanagement interessant. Ich glaube, für die Arbeit im Bildungswesen sollte einem dieses wirklich am Herzen liegen, also dass man das Thema Bildung für die nächste Generation mitgestalten möchte. Das ist schon mal sehr viel wert, auch wenn man beim Berufseinstieg vielleicht noch nicht so weit von der nächsten Generation weg ist.
Hast Du Kolleginnen oder Kollegen mit einem mathematischen Hintergrund?
Ich betreue ja von Programmmanagementseite hauptsächlich die Mathematik und entsprechend werden andere Fächer jeweils von jemandem mit dem jeweiligen Hintergrund betreut. Da wir Mathematik und Naturwissenschaften zusammengelegt haben, sind wir dann redaktionsseitig zum Beispiel mit Kollegen aus den Bereichen Physik, Chemie und Biologie aufgestellt. Es gibt auch Kollegen, die zum Beispiel Mathematik auf Lehramt studiert haben und bei uns im Bereich der kaufmännischen Berufe arbeiten.
Damit beziehst Du Dich sicher auf den Standort Köln. Wie viele Menschen arbeiten dort?
Genau, das ist unser Standort für die berufliche Bildung. Hier arbeiten ungefähr sechzig bis siebzig Personen. Der Standort in Köln war früher mal ein eigenständiger Verlag, der in die Westermann-Gruppe eingegliedert wurde und seitdem die berufliche Bildung betreut. Der Hauptstandort der Westermann-Gruppe, wo der Großteil der Allgemeinbildung sitzt, ist in Braunschweig.
Würdest Du sagen, das Mathematikstudium hat Dich geprägt?
Ja, ich glaube schon. Ich habe gewisse Denkstrukturen verinnerlicht, dass man sehr viel versucht, logisch zu durchdringen und sich nicht so leicht mit etwas zufrieden gibt, das nur gefühlt richtig ist. Diese Tendenz wird durch ein Mathematikstudium sicher noch mal mehr gestärkt. Im echten Leben ist das aber vielleicht auch nicht immer der richtige Weg und man muss am Ende einen Mittelweg finden.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führte Kari Küster.