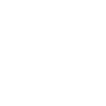Wie funktioniert das Zusammenspiel von Ökosystemen in einer Landschaft – vom Boden mit seinen unzähligen Mikroorganismen über die Pflanzen bis zu den Tieren – und wie können Menschen darin leben und wirtschaften, ohne ihre Lebensgrundlage zu zerstören? Diese Fragen erforscht Ralf Seppelt am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig. Der studierte Mathematiker und Landschaftsökologe setzt dafür auf mathematische Modelle und Simulationen. Die besten Momente erlebt er, wenn es ihm gelingt, einfachen Modellen weitreichende Aussagen über die Wirklichkeit zu entlocken.
Wie funktioniert das Zusammenspiel von Ökosystemen in einer Landschaft – vom Boden mit seinen unzähligen Mikroorganismen über die Pflanzen bis zu den Tieren – und wie können Menschen darin leben und wirtschaften, ohne ihre Lebensgrundlage zu zerstören? Diese Fragen erforscht Ralf Seppelt am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig. Der studierte Mathematiker und Landschaftsökologe setzt dafür auf mathematische Modelle und Simulationen. Die besten Momente erlebt er, wenn es ihm gelingt, einfachen Modellen weitreichende Aussagen über die Wirklichkeit zu entlocken.
Herr Professor Seppelt, Sie haben in den neunziger Jahren Technomathematik studiert. Warum haben Sie angefangen sich für ökologische Fragen zu interessieren? Das lag an der Ausrichtung des Studiengangs. Wir waren an der Technischen Universität Clausthal gezwungen, neben dem vollständigen Mathematikstudium auch Informatik und ein ingenieurtechnisches Anwendungsfach zu belegen. Ich entschied mich für Mess- und Regelungstechnik. In diesen Vorlesungen haben die Mathematiker unter uns sofort den Algorithmus vorne an der Tafel durchblickt, aber eben auch gelernt, was das für die Anwendung bedeutet. Weil ich diese Anwendungen so spannend fand, habe ich mir eine Diplomarbeit bei den Ingenieuren gesucht.
Zu einem Thema aus der Ökologie? Ja, ich habe sozial-ökologische Systeme modelliert. Es ging um die Akzeptanz von Recyclingsystemen und die Frage, wie viel Subventionen notwendig sind, damit diese Systeme stabil bleiben. Damit war ich schon mitten im Bereich Umwelt und vor allen Dingen bei Modellen und Simulationsanwendungen angekommen.
Es war also eher Zufall, dass sie begonnen haben, Mathematik auf ökologische Fragestellungen anzuwenden? Ja, eigentlich wollte ich an der Uni vor allem eines: meinen Horizont erweitern, mich mit anderen Disziplinen beschäftigen, aber auch in die Tiefe gehen. Ich hatte zwar eine gewisse Affinität zum Umweltbereich, aber dass ich dann auch noch eine Promotionsstelle an der Technischen Universität Braunschweig bekommen habe, wo es um Agrarökosysteme ging, war wiederum Zufall.
Seit 2004 leiten Sie die Abteilung Landschaftsökologie am UFZ. Ihr Forschungsgebiet ist das Landressourcenmanagement und speziell die Frage nach den Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur. Was heißt das genau? Ökosysteme werden meist in irgendeiner Form vom Menschen genutzt, sei es weil wir dort leben, Nahrung produzieren oder weil wir sauberes Wasser brauchen. Fast überall auf der Welt ist alles, was in unseren Landschaften passiert, anthropogen überprägt, vom Menschen beeinflusst. Das ist die eine, die sozioökologische Seite. Auf der anderen Seite verstehen wir über weite Strecken gar nicht, wie die Ökosysteme selbst funktionieren. Wir verstehen zwar einzelne Prozesse wie die Photosynthese, Pflanzenwachstum oder Bestäubung. Anders sieht es aus, wenn wir Landschaften betrachten. Welche Hecken oder Wälder brauchen wir zum Beispiel, um ausreichend Insekten zu haben, die Schädlinge bekämpfen oder Blüten bestäuben, damit wir die Nahrung produzieren können, die wir brauchen – das ist in Teilen unbekannt. Wir Landschaftsökologen müssen also zwei Fragen beantworten: Wie funktionieren Ökosysteme und wie können wir sie so nutzen, dass wir ausreichend Erträge erzielen, ohne dabei Ökosysteme zu stark zu verändern.
Können Sie das an einem Beispiel erläutern? Wir haben ein Forschungsprojekt auf den Philippinen, da geht es um die Populationsdynamik von Insekten, die einen Schädling bekämpfen: einen kleinen braunen Käfer, der sich sehr schnell ausbreitet und die Reisfelder befällt. Die Reisbauern sind der Meinung, dass man dagegen am besten mit Pestiziden vorgeht. Wir meinen, es kann von Vorteil sein, genau das nicht zu tun. Denn mit den Pestiziden erwischt man auch die Insekten, die die Schädlinge bekämpfen. Von der dynamischen Modellierung her stellt sich hier die Frage, wann der richtige Zeitpunkt für welche Maßnahme ist. Der Einsatz von Pestiziden kann sinnvoll sein, aber es kann auch sein, dass es sich lohnt ein paar Tage damit zu warten, weil die natürliche Schädlingsbekämpfung das Problem löst, und zwar langandauernder. Mathematisch gesehen sind das dynamische Prozessmodelle, Differenzialgleichungen, die ich parametrisieren muss. Und die ermöglichen dann auch eine Simulation.
Es geht darum, den idealen Zeitpunkt für den Einsatz der Pestizide zu finden. Ja, genau, das sind dann tatsächlich nicht-lineare Optimierungsprobleme.
Seit wann werden ökologische Prozesse überhaupt modelliert? Schon ziemlich lange. Die klassischen Lehrbücher sind aus den neunziger Jahren. Letztlich geht das Modellieren in der Ökologie zurück auf Überlegungen in der theoretischen Biologie, wie man mit gekoppelten Differenzialgleichungssystemen RäuberBeute-Phänomene erkennen kann. Und seit es leistungsstarke Rechner für Simulationen gibt, also seit etwa dreißig Jahren, haben Biologen die Mathematik eben auch auf reale Prozesse angewendet. Diese Entwicklung verlief parallel zur Modellierung in der Klimaforschung.
Das Klima mit seinen vielen Wechselwirkungen erscheint schon enorm komplex. Sind Modelle, die ökologische Systeme nachbilden, nicht noch weit dynamischer und komplexer? Nicht unbedingt. Auch die Berichte des Weltklimarats IPPC sind zunehmend komplex. Am Anfang haben sie die Atmosphäre beschrieben, zwanzig Jahre später auch noch die Bodenschichten und die Ozeane mit den Austauschprozessen, die dort stattfinden. Irgendwann kam die Vegetation hinzu. Wie komplex muss ich die Simulation gestalten und wann muss ich aufhören? Über diese Frage gibt es eine weit zurückreichende und immer noch aktuelle Diskussion unter Modellierern. Und diese Frage ist vor allem unter dem Aspekt wichtig, dass ich Ergebnisse auch kommunizieren will und muss. Denn, baue ich ein einfaches Modell, das sich leicht erklären lässt und entscheidende Muster zeigt, die wichtige Erkenntnisse bringen, dann heißt es womöglich: Das ist zu simpel! Ist das Modell komplizierter und damit vielleicht realitätsnäher, dann heißt es: Die Voraussagen sind zu unsicher.
Wie gehen Sie vor, wenn Sie ein ökologisches System modellieren? Ich fange an, indem ich es konzeptuell beschreibe, dann codiere ich die einzelnen Prozesse mathematisch. Meistens stelle ich dann fest, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe. Daraus lerne ich, welche ökologischen Prozesse ich eigentlich hätte berücksichtigen sollen. Und ich lerne einzelne Prozesse innerhalb eines Ökosystems besser zu verstehen. Insofern ist der Aufbau des Modells die entscheidende Phase. Dieser Modellierungsprozess und dann die Entscheidung, wie komplex ich mein Modell mache, welche Daten und Prozesse ich mit einbeziehe und welche nicht, das ist der eine Schritt. Der andere betrifft die mathematische Methodik.
Wo liegen die mathematischen Herausforderungen? Wir werden in der Statistik in Zukunft eine größere Kompetenz in der Analyse von großen und auch heterogenen Datenbeständen benötigen. Denn wir vermessen Landschaften inzwischen auch durch Fernerkundung vom Flugzeug aus oder via Satellit und generieren dadurch wesentlich dichtere Daten. Die zweite Herausforderung betrifft die Integration. Wenn wir immer mehr Prozesse in die Modelle mit hineinnehmen, weil wir Ökosysteme sonst nicht richtig beschreiben können, dann reichen einfache Differenzialgleichungen irgendwann nicht mehr aus. Wenn ich mit diskreten Prozessen oder Störungen, also für Mathematiker sehr unangenehmen, nichtlinearen Phänomenen umgehen muss, kann ich die nicht mehr mathematischanalytisch, sondern nur noch numerisch handhaben.
Wie lösen Sie diese Probleme? Wir setzten hier am UFZ immer mehr Algorithmen auf, mit denen wir die bestehenden Modelle analysieren. Das heißt, wir machen Optimierungsläufe und suchen auf diesem Wege nach Kombinationen für eine optimale Nutzung von Land. Dafür braucht man sehr viel Numerik und auch Hochleistungsrechner.
Arbeiten Sie dafür mit Mathematikern zusammen? In der Abteilung Landschaftsökologie am UFZ arbeiten zurzeit zwei Mathematikerinnen, beide sind Doktorandinnen. Die sind sozusagen, genau wie ich, auf die „schiefe Bahn“ geraten. Die anderen der insgesamt dreißig Kolleginnen und Kollegen sind allesamt Umweltwissenschaftler mit einem stark quantitativen analytischen Background.
Sie leiten aus den Simulationen auch Empfehlungen ab, für die Reisbauern auf den Philippinen genauso wie für Obstbauern in Sachsen, Regierungen oder internationale Organisationen. Worauf kommt es bei der Kommunikation dieser Ergebnisse an? Eine Lösung zu haben ist das eine, aber dann zu erklären, was das für die Anwendung heißt, das ist eine der ganz großen Herausforderungen. Das musste ich auch erst lernen. Ein Beispiel: Wir haben im letzten Jahr eine Studie publiziert, mit der wir mathematisch zeigen konnten, dass nicht nur Ressourcen wie Erdöl, sondern auch die nachwachsenden Energie- und Nahrungsressourcen, die wir auf der Welt haben, limitiert sind. Dafür hatten wir ein einfaches Grundmodell aus der Ressourcen-Ökonomie genommen. Die mathematische Analyse war vergleichsweise aufwendig, allein der Methodenteil in dem Paper nahm mehrere Seiten ein. Aber die inhaltliche Diskussion der Ergebnisse war weitaus länger. Und das war gut so. Wir konnten wirklich eine Botschaft vermitteln. Die Studie hat in der Fachwelt eingeschlagen und auch in der Presse für viel Wirbel gesorgt. Allein mit der Mathematik wäre das nicht möglich gewesen, aber ohne Mathematik eben auch nicht. Manchmal muss man da gar nicht mit großer, komplizierter Mathematik herangehen. Ein sehr einfaches Modell kann, wie in diesem Fall, einen unheimlich reichhaltigen Schatz an Ergebnissen liefern. Und das ist es, was mich letztlich an der Anwendung der Mathematik in den Umweltwissenschaften reizt.
Ist Mathematik in diesem Sinne für Sie ein Instrument oder mehr? Mathematik ist für mich mehr! Sie ist eine Art und Weise, wie ich denke, wie ich an Sachen herangehe. Die zeigt sich insbesondere in der Phase, in der ich die mathematischen Modelle konzipiere. Und genau in dieser Vorgehensweise, in diesem Systemverständnis, liegt für mich die eigentliche Leistung der Mathematik.
Würden sie jungen Mathematikerinnen und Mathematikern, die sich für das Anwendungsgebiet Ökologie interessieren, über das Mathematikstudium hinaus noch ein Fachstudium empfehlen? Im Prinzip reicht ein Mathematikstudium. Aber man sollte während des Studiums über den Tellerrand hinausschauen. Es reicht schon, ein echtes Interesse an einer praktischen Fragestellung zu haben. Und das muss nicht mal unbedingt eine ökologische Fragestellung sein. Eine unserer beiden Mathematikerinnen hier hat zum Beispiel für ihre Diplomarbeit Feldversuche eines Agrarforschungsinstituts analysiert und dabei neue Methoden der Statistik ausprobiert. Das war statistisch interessant, außerdem zählte für sie, dass sie reale Datensätze verwenden konnte. Die andere hat im Rahmen eines Auslandsaufenthalts in Australien Planungs- und Optimierungsmodelle aus der Ökonomie genommen, um Naturschutzflächen zu planen und Kosten optimal auszuweisen. Ihre Arbeitsgruppe an der Uni hat den gesamten Naturschutzplan für das Great Barrier Reef vor der Nordküste Australiens umgesetzt. Man kann Mathematik in so unglaublich vielen Bereichen anwenden, nicht nur im Banken- und Versicherungssektor. Aber man braucht eine gewisse Offenheit, um dorthin zu gelangen.
Kristina Vaillant ist freie Journalistin in Berlin und arbeitet regelmäßig für das Medienbüro der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.