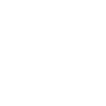Swantje Gährs treffe ich Anfang Dezember vergangenen Jahres online, sie sitzt in ihrem privaten Arbeitszimmer in Hamburg. Hinter ihr eine Wand mit Fotos, die sie auf Reisen geschossen hat. Auch die von einem Trip nach Japan und China, wo sie nachhaltige Formen der Energieversorgung studiert hat. Die promovierte Mathematikerin ist Expertin für dezentrale Energieversorgung und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) in Berlin.
 Swantje Gährs. Foto: IÖW
Swantje Gährs. Foto: IÖW
Frau Gährs, eine politische Frage vorneweg: Sind Sie zufrieden damit, was die neue Bundesregierung im Koalitionsvertrag zum Thema Klimaschutz und Energieversorgung ausgehandelt hat?
Den Koalitionsvertrag habe ich mir lustigerweise gerade heute Morgen in Ruhe zu Gemüte geführt. Er steht unter der Überschrift sozial-ökologische Marktwirtschaft, woran man ganz gut erkennen kann, dass der erste Teil eher von den Grünen, der zweite Teil eher von der FDP reingekommen ist. Was natürlich total schön ist, ist, dass die jetzt doch versuchen, das 1,5-Grad-Ziel zu halten. Man muss natürlich gucken, wie sie das umsetzen, aber man sieht schon, dass es großen Handlungsdruck gibt, da soll schnell viel passieren. Aber abgesehen davon, dass der Ausbau der Photovoltaik und der Windkraft vorankommen soll, ist das Thema der dezentralen Energieversorgung tatsächlich ein bisschen dünn aus meiner Sicht. Es gibt eine Passage, wo gesagt wird, dass man sogenanntes Energy Sharing voranbringen will, aber es gibt zum Beispiel kein klares Commitment zu Bürgerenergie oder so was. Andererseits ist es auch verständlich, dass man erst mal Ziele formuliert und die dann im Laufe der Regierung konkretisiert.
Ihr Arbeitgeber, das Institut für ökologischenWirtschaftsforschung, konzentriert sich lautWebsite auf praxisorientierte Nachhaltigkeitsforschung.Was machen Sie dort als Mathematikerin?
Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung ist ein rein drittmittelfinanziertes Institut und gehört zu keiner Universität. Wir sind komplett unabhängig und haben keine Grundfinanzierung, das heißt, wir machen drittmittelfinanzierte Projekte. Und da sind wir interdisziplinär und eben auch transdisziplinär tätig. Das heißt, in meinem Team gibt’s keine anderen Mathematiker oder Mathematikerinnen, sondern das sind Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftlerinnen, Ökologinnen, Politologinnen, das ist ganz divers. Und je länger man dort arbeitet, desto mehr löst man sich von der eigenen Disziplin. In meinem Team sind wir jetzt aktuell 16 Leute und die Projekte, die wir machen, sind eigentlich zum Großteil Projekte mit Partnern. Das können Unternehmen sein, die ihre Forschungsfragen mitbringen, und wir gucken dann, welche Fragen haben wir eigentlich, wenn es darum geht, die Zukunft zu gestalten. Daraus entsteht dann ein gemeinsames Projekt. Ziel ist, die Forschungsergebnisse gleich in die Umsetzung zu bringen.
Sind das Partner aus der Energiebranche?
Ja, häufig natürlich aus der Energiebranche. Aber nicht nur Energieversorger oder Netzbetreiber, sondern auch Bürgerenergie-Gemeinschaften, Städte, Verbände oder Kommunen. Wir haben auch häufig Projekte, wo wir Kommunen unterstützen, die beispielsweise eine nachhaltige Quartiersentwicklung wollen.
Gehört Politikberatung damit auch zu ihrem Arbeitsgebiet?
Sehr wenig, aber unsere Projekte werden zum größten Teil aktuell von den Bundesministerien gefördert. Wir sind eine gemeinnützige GmbH, wobei man dazu sagen muss, und das ist vielleicht auch etwas Besonderes: die Gesellschafter des Instituts sind zum größten Teil die Mitarbeiter. Das heißt, uns gehört das Institut auch ein Stück weit selbst.
Erzählen Sie uns bitte von einem Projekt, das repräsentativ für Ihre Arbeit ist.
Ich hatte letztes Jahr ein EU-Projekt, das sich mit Prosumern in der EU beschäftigt hat. Das ist von der Aufgabenstellung her schon typisch.
Was sind Prosumer in diesem Zusammenhang?
Prosumer sind Haushalte oder größere Gemeinschaften, die ihren Strom selber erzeugen und verbrauchen, auch wenn sie nicht autark sind. Diese Prosumer sind wichtig für den dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Solaranlagen, die wir in Deutschland haben, die sind hauptsächlich aus privatem Kapital finanziert. Und der Vorteil, wenn die Leute auch ein Stück weit selber verbrauchen, was sie produzieren, ist, dass sie mehr Bewusstsein entwickeln für das, was da passiert, also mehr ökologisches Bewusstsein. Und wenn die dann auch noch versuchen, sich ein bisschen abzustimmen mit ihrer Erzeugung, dann entlastet das auch die Stromnetze. Die Idee ist also, dass die auch einen Mehrwert fürs Energiesystem haben.
Was haben Sie in dem EU-Projekt erforscht?
Das ist eigentlich ein Projekt gewesen, was eher sozialwissenschaftlich geprägt war. Es hieß „Prosumer for the Energy Union“, und da ging es darum zu gucken, wie in sieben verschiedenen Ländern der EU der Stand der Prosumer ist. Der Hauptfokus des Projekts war die Frage, wie man Anreize setzen kann und welchen Rahmen Prosumer brauchen – ökonomisch und regulatorisch –, um wachsen zu können. Und da gab zwei Bausteine: Einmal hat man sich die Lage insgesamt angeguckt, und dann gab es in jedem Land sogenannte Living Labs, also echte Projekte, die wir begleitet und unterstützt haben. Das war in meinem Fall ein Projekt im Süden von Bremen, wo eine Gemeinde ein innovatives Nahwärmekonzept umsetzen wollte und dafür auch dezentrale Wärmeerzeuger einbinden wollte, also zum Beispiel eine Solarthermieanlage irgendwo auf dem Dach. Da haben wir ein paar Workshops gemacht. Das war total spannend zu sehen, was die Bürger eigentlich interessiert. Warum würden die da mitmachen wollen oder auch nicht? Der andere Baustein war eine technischökonomische Simulation der Prosumer-Gemeinschaften. Dafür haben wir mit einem Partner in Kroatien und einem Partner in den Niederlanden zusammengearbeitet. Wir haben die unterste Ebene, einzelne Prosumer, einzelne Quartiere abgebildet; die in Kroatien haben sich eher um Städte gekümmert, und in den Niederlanden haben sie sich die Länderebene und die EU-Ebene angeguckt. Und wir haben eben auch versucht, diese Living-Labs abzubilden; zum Beispiel ein Quartier in den Niederlanden, das schon ganz weit war, das Photovoltaik hatte und auch schon Batteriespeicher und das uns auch Verbrauchsdaten zur Verfügung stellen konnte.
Stichwort Simulation – ist bei ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin vielleicht doch Mathematik im Spiel?
Tatsächlich habe ich damals im Institut angefangen mit der Aufgabe, die Modellierung und Simulation zu übernehmen, und das habe ich zunächst auch gemacht. Die haben gezielt jemanden gesucht, der sich dieser Aufgabe gewachsen fühlt. Ich habe also mit dem mathematischen Hintergrund hier angefangen, und vorher hatte ich noch bei einer Unternehmensberatung gearbeitet und da begleitend eine IHK-Fortbildung zur Energiewirtschaftsmanagerin gemacht – also ein bisschen den fachlichen Background aufgebaut. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich meine Kollegen, die an dem Prosumer-Modell arbeiten, anleite oder ihnen Tipps gebe. Und dann mache ich auch mal ökonomische Berechnungen, aber wahrscheinlich würden viele Mathematiker das nicht Mathematik nennen [lacht].
Die würden wahrscheinlich eher von Rechnen sprechen.
Genau, rechnen, das mache ich ab und zu.
Sie haben schon erwähnt, wie Sie zu ihrem Arbeitsgebiet gekommen sind. Aber wie haben Sie nach Abschluss Ihrer Promotion 2011 überhaupt den Übergang von der akademischen Forschung in die Praxis geschafft?
Ich hatte in algebraischer Geometrie promoviert, da ist es aus meiner Sicht schon ein bisschen schwierig, den Sprung in die Praxis zu schaffen. Aber ich hatte schon während meiner Doktorarbeit gemerkt, dass mir die Grundlagenforschung ein bisschen schwer fällt. Da braucht man aus meiner Sicht viel intrinsische Motivation. Das liegt mir nicht so. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich lieber einen kompletten Cut: Bevor ich Mathematik mache, die ich nicht so toll finde, mache ich lieber ganz was anderes. Energiethemen fand ich schon damals total interessant und habe mich deswegen in die Richtung beworben. Bei den Rückmeldungen hatte ich das Gefühl, da gibt es Leute, die wissen zu schätzen, dass man Mathe studiert hat und lösungsorientiertes Arbeiten gelernt hat, und die denken, dass man das Fachliche dann auch schnell hinkriegt.
Sie haben auch Meteorologie im Nebenfach studiert, das geht ja schon in Richtung Anwendung.
Ja, stimmt. Aber das ist weder in meine Diplomarbeit noch in meine Doktorarbeit eingeflossen. Eine gewisse Affinität zu dem Umweltthema hatte ich dadurch aber schon.
Und wie sind Sie als Schülerin auf die Idee gekommen, Mathematik zu studieren?
Ich sage immer, es war das, was ich am besten konnte. Es ist mir tatsächlich immer leichtgefallen, und ich habe es immer gerne gemacht. Es war das einzige Fach, wo ich in meiner Schulkarriere durchgehend meine Hausaufgaben selber gemacht habe, und da dachte ich dann, warum nicht? Und das Schöne war ja auch, damals gab es noch keinen NC, das heißt, ich konnte mir aussuchen, wo ich hingehen möchte.
Sie haben in Berlin an der Freien Universität studiert, sind aber nicht gebürtig aus Berlin.
Nein, gebürtig komme ich aus Hamburg, bin aber in Buxtehude groß geworden. Ich wollte gern in eine Großstadt und nicht in den Süden. Wenn ich in Hamburg studiere, hat mein Vater gesagt, dann könnte ich ja zu Hause wohnen bleiben. Und dann dachte ich, nee, jetzt muss ich auch mal raus.
Lassen Sie uns auf ihren Arbeitsalltag blicken. Gibt es Aufgaben, die typisch sind für ihre Tätigkeit?
Ich würde sagen, typisch ist tatsächlich, dass wir viel Austausch haben, weil es eben so ein interdisziplinäres Team ist. Man erarbeitet sich ein Thema natürlich ein Stück weit selbst, aber man muss sich häufig rückkoppeln mit Kollegen, besonders dann, wenn man daraus ein Fazit zieht oder Empfehlungen ableitet. Denn das machen wir eigentlich immer in einem größeren Team, wo dann ganz unterschiedliches Wissen und Erfahrungen dahinterstecken. Typisch ist auch, dass man eigentlich immer auf der Suche nach neuen Ideen und Projekten ist, denn ich muss ja auch selber dafür sorgen, dass ich meinem Job behalte.
Sie machen also auch Akquise.
Ja, Projektakquise, Projektanträge schreiben, Partner suchen, alles, was dazugehört; sich überlegen, wie viel Zeit man braucht für die einzelnen Arbeitsschritte und so weiter und so fort. Und dann gehören viele klassische Projektmanagementarbeiten zum Arbeitsalltag.
Gibt es Tätigkeiten, die zu ihren Lieblingsaufgaben gehören?
Ja, tatsächlich mag ich es gerne, wenn es darum geht, etwas zu strukturieren. Und da ist mir auch egal, was das ist. Zum Beispiel, wenn wir ein neues Projekt haben und es geht darum einen Antrag von 15 Seiten in einen Arbeitsplan zu übersetzen: Was baut eigentlich aufeinander auf? Was ist voneinander abhängig, und wo sind vielleicht Fallstricke zu erwarten? Oder wenn ich meine Kollegen bei der Modellierung begleite, dann finde ich das auch immer schön zu gucken, an welchen Stellen muss ich ins Detail gehen und an welchen kann ich Daten auch oberflächlich ins Modell einpflegen. Struktur reinbringen – solche Aufgaben finden sich eigentlich an ganz vielen Stellen.
Das klingt als ob Ihr Mathematikerinnen-Sein hier zum Tragen kommt. Sehen Sie sich eigentlich als Mathematikerin?
Also, man hat sich das ja ausgesucht, so ein Studium. Und wenn man am Ball bleibt, zeigt das schon, dass man dafür auch eine große Liebe hat. Und trotzdem tue ich mich mittlerweile mit nur einer Berufsbezeichnung total schwer.
Wenn Sie jetzt jemand fragen würde, was sind Sie von Beruf, was würden Sie antworten?
Dann sage ich wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Wenn man als ausgebildete Mathematikerin oder Mathematiker einsteigen möchte in die nachhaltigkeitsorientierte Forschung für die Praxis, wie macht man das am besten?
Erst mal glaube ich, man muss einfach darauf vertrauen, dass man ganz viele Qualitäten mitbringt aus dem Studium. Und dann braucht man eben auch das Gegenüber, das weiß, dass man die fachlichen Sachen schnell aufbauen kann und dafür auch eine gute Auffassungsgabe mitbringt.
Kann man bereits im Studium drauf achten, dass man die passenden Kompetenzen entwickelt?
Man kann das natürlich auch während des Studiums machen. Ein Praktikum ist immer eine Möglichkeit, darüber kann man einfach mal in eine andere Richtung reinschnuppern. Und wenn man sich wirklich für Nachhaltigkeitsthemen interessiert, dann gibt es an den Universitäten ganz viele studentische Initiativen, an denen man sich beteiligen kann. Ich scheue mich aber immer ein bisschen davor zu sagen, man sollte dies und das machen. Man sollte eigentlich das machen, was einen interessiert. Und wenn es eben Nachhaltigkeitsthemen sind, dann wird man automatisch mal in die Richtung gucken und sehen, wo sich Möglichkeiten ergeben.
Zum Schluss möchte ich noch mal auf die Zukunft der Energieversorgung zurückkommen.Welchen Beitrag können die Prosumer dazu leisten?
Rein theoretisch ist es schon möglich, dass man in Deutschland etwa 80 Prozent des Strombedarfs mit solchen Prosumer-Anlagen deckt – wenn man wirklich alle Dachflächen nutzt. Gegenwärtig sind es erst um die zehn bis 15 Prozent.
Frau Gährs, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Das Gespräch führte Kristina Vaillant,
freie Journalistin in Berlin.
www.vaillant-texte.de