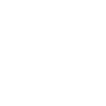Oliver Schaudt treffe ich Ende Dezember am Bildschirm, er sitzt bei sich zu Hause in Köln am Schreibtisch. Für den Mathematiker geht nicht nur das Jahr 2020 zu Ende, sondern auch seine Tätigkeit als mathematischer Berater beim Automobiltechnologie-Konzern ZF Friedrichshafen. Für diese Aufgabe hatte er vor zwei Jahren seine akademische Karriere aufgegeben. Nun steht für den KI-Experten der Wechsel in die Pharma-Branche an.
 Oliver Schaudt. Foto: LinkedIn Profil Oliver Schaudt
Oliver Schaudt. Foto: LinkedIn Profil Oliver Schaudt
Herr Schaudt, Sie haben nach dem Mathematikstudium an der Universität Köln knapp zehn Jahre lang erfolgreich Karriere im akademischen System gemacht, zuletzt waren sie Professor für Data Science an der Technischen Hochschule in Aachen. Hat die Industrie Sie abgeworben?
Ja, ein klein bisschen schon. Die RWTH Aachen ist eine Super-Uni, mir hat das viel Spaß gemacht, auch die Lehre. Aber ich habe es eben zehn Jahre lang gemacht und bekam dieses interessante Angebot, in der Industrie als Spezialist Probleme zu lösen. Ich dachte wenn, dann ist das jetzt der Zeitpunkt, um noch mal etwas Neues auszuprobieren.
Was hat Sie gereizt? Eine Professur auf Lebenszeit, auf die man lange hingearbeitet hat, gibt man nicht so ohne weiteres auf.
Die Professur in Aachen war auf fünf Jahre befristet, aber das war jetzt weniger mein Motivator. Es waren mehr die Rahmenbedingungen, also etwas völlig Neues machen zu können und das mit einem engen Bezug zu meinem akademischen Hintergrund – Algorithmen, diskrete Optimierung und ein stückweit auch Data Science – und dann noch in einem spannenden Feld: autonomes Fahren und die Entwicklung autonomer Fahrfunktionen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Entwicklung von Konzepten für Hybrid-Getriebe. Das war so eine spannende Herausforderung und der Konzern hat das auch so dargestellt, dass ich Lust darauf bekommen habe, da fiel es mir schwer, Nein zu sagen. Und man muss auch sagen, dass die Gehälter an der Uni nicht mehr so sind wie vor 50 Jahren, da kann ein Konzern durchaus mithalten oder das auch übertreffen.
Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?
Ja, das würde ich schon sagen.
Sie waren rund zwei Jahre für den Technologiekonzern ZF Friedrichshafen als mathematischer Berater tätig. Laut Website produziert das Unternehmen Softwarelösungen für die Steuerung von Fahrzeugen, Getrieben und für Mobilität insgesamt.Wen haben Sie beraten und welche Art von Projekten haben Sie geleitet?
Ein Beispiel ist die Entwicklung von Getriebekonzepten. Es ist ja nicht ganz klar ist, ob nicht das Ende der Getriebe angebrochen ist oder ob wir gerade erst am Beginn einer neuen Art von Getriebesystem stehen. Der Autobauer Tesla zum Beispiel verbaut keine Getriebe, aber Elektroautos von Porsche beispielsweise benutzen Getriebe. Früher saß da ein Ingenieur dran und hat in seiner ingenieursmäßigen Genialität ein Getriebe von Hand erfunden. Aber heute hat ein Getriebe viele Zusatzfunktionen; beim Hybridgetriebe eine Elektromaschine, die hilft, der klassische Verbrenner, der hilft auch, und irgendwann kommt auch noch die Brennstoffzelle dazu. Diese vielen Eingabekräfte müssen geschickt miteinander „verheiratet“ werden, um ein möglichst komfortables Fahren zu ermöglichen. Diese Getriebe sind außerdem Automatikgetriebe, das heißt, es gibt zusätzlich noch eine interne Logik, die den Ablauf steuert. Wenn man so etwas neu erfinden möchte – und in dieser Situation sind momentan die Autobauer – dann ist das auf der einen Seite weniger aufwändig als früher was die Bauteile angeht, auf der anderen Seite sind solche Getriebe von der Funktionalität und von der Qualität des Fahrgefühls her viel aufwändiger zu konzipieren.
Die Steuerung eines Getriebes ist viel komplizierter geworden.
Genau. Und BMW oder Porsche, solche Premiumhersteller, mit denen ZF zusammenarbeitet, die erwarten Fahrqualität, die muss schon in der Mathematik drinstecken, mit der man das ganze erfindet. Wenn ich so ein System erfinden möchte, dann ist es in der Regel so, dass die Ingenieure einen Suchraum definieren – ich möchte diese Art von Bauteil verwenden, diese Art von Elektromaschine, diese Art von Verbrenner – und dann fragen: Was ist dafür das beste Konzept? Für mich als Mathematiker ist das ein sehr großes diskretes Optimierungsproblem, denn ich habe jede Menge Systeme, die ich theoretisch bauen könnte. Da geht es also um Kombinationen von endlichen Objekten und das heißt, da muss man viel diskrete Optimierung, Kombinatorik und auch einige nicht-lineare Optimierungen anwenden, wenn es an Feinheiten geht; beispielsweise, wie sich die Drehmomente im Getriebe verhalten. Bei solchen Problemen kommen Zweige zusammen, die in der Mathematik eigentlich klarer getrennt sind, und die können dann nur mithilfe der richtigen Algorithmen gelöst werden. Man muss also in die akademische Trickkiste greifen. Und das war letztlich auch der Grund, warum ich angeheuert wurde. Andererseits musste ich mir neben der Theorie auch Gedanken über das Softwaredesign machen. Das war neu für mich. Etwa die Frage, wie wir Berechnungen geschickt auf einer IT-Infrastruktur parallelisierten, damit ich möglichst viele Kerne gleichzeitig nutze, aber nicht ewig lange suchen muss. Ich finde das ist ein spannendes Projekt, weil man völlig auf Mathematik und auf Algorithmen angewiesen ist. Ohne dieses Know-how braucht man gar nicht anzufangen, diese Räume zu durchsuchen. Da wird algorithmische Mathematik wirklich zum Wettbewerbsvorteil, und da findet ein Wandel bei den Skills statt, die heute im Bereich Automotive gebraucht werden.
Das heißt, Sie haben bei ZF hauptsächlich mit Ingenieuren zusammengearbeitet.
Ja, genau. Ich habe in der Gruppe „Enabling Technologies“ gearbeitet, unter diesem Namen wird die Mathematik zusammengefasst, so etwas gibt es in einigen Konzernen. Wir waren eine Vierer-Gruppe, darunter ein promovierter Numeriker, und standen immer in sehr engem Kontakt mit den Ingenieuren. Das war ein gewisses Spannungsfeld, denn die Getriebeentwicklung ist eigentlich immer deren absolutes Hoheitsgewässer gewesen.
Was hat Ihnen besonders gefallen? War es dieses, wie Sie es genannt haben, in die „akademische Trickkiste greifen“, um ein Problem zu lösen?
Ja, weil man als Mathematiker auch sehr viel Beinfreiheit genossen hat. Also wenn man sagt, ich habe eine Idee, die könnte funktionieren, das probiere ich jetzt mal aus, dafür brauche ich aber zwei Wochen, dann gibt es durchaus Respekt dafür. Ob das überall so ist, weiß ich nicht, aber in dem Fall war es so. Es gibt mittlerweile Verständnis dafür, dass man nicht alles vorher theoretisch wissen kann, gerade wenn es um so große praktische Probleme geht, wo vieles ineinander greift. Meine objektive Beobachtung ist, dass man auch in großen Konzernen durchaus auf tiefgehende mathematische Probleme trifft und Zeit hat, daran zu forschen. Und ich habe das Gefühl, das wird für diese Unternehmen immer wichtiger. Natürlich gibt es solche und solche Stellen, es wird nicht überall so rosig sein, aber man sollte, selbst wenn man weiß, man möchte in der Forschung bleiben, vielleicht auch die Forschung außerhalb des Akademischen suchen. Man braucht jedenfalls keine Angst zu haben, dass man das da nicht machen kann.
Und wie war die Auseinandersetzung mit den Ingenieuren?
Das war für mich persönlich der spannendere Teil, schließlich bin ich ja gewechselt, um zu sehen, wie eine andere Disziplin auf ein Problem blickt, das wir völlig abstrakt verstehen wollen. Wie erfindet man eigentlich ein Getriebe, wie kommt man zu einem Patent? Im akademischen Bereich kann man ein Paper schreiben, über das Leute noch 20 Jahren später sprechen, aber die Communites sind doch eher auf sich bezogen. Es ist etwas anderes, wenn man ein Getriebekonzept entwickelt, das noch sieben Jahre lang braucht, bis es serienreif ist. Man bestimmt ganz am Anfang bei der Geburt des Systems mit, was gebaut wird und wofür bei der Entwicklung die eine Milliarde investiert wird, um das Getriebe dann nachher an die Autobauer zu verkaufen. Das ist ein ganz anderer Impact.
Haben Sie durch die enge Zusammenarbeit mit den Ingenieuren dazugelernt?
Ja, auf jeden Fall. Technisch musste ich etwas über Getriebe lernen, zumindest das Basis-Know-how, um das dann auch mathematisch modellieren zu können. Die Kollegen haben auch so kommuniziert, dass man das versteht. Sie erklären die Dinge auch gerne mehrmals, das ist meine Erfahrung. Wenn man dann ein gewisses technisches Verständnis hat, dann kann man auch verstehen, was die Ingenieure normalerweise alles an Intuition mit reinbringen würden, was denen einen Startvorteil gegenüber einem Algorithmus verschafft.
Anfang 2021 fangen Sie bei Bayer in Leverkusen an. Nach diesen positiven Erfahrungen in der Automobilbranche warum jetzt Chemie und Pharma?Was ist der Grund für diesen Wechsel?
Für mich war das wichtigste, dass meine Frau und meine Kinder hier in Köln sind. Vorher bin ich jede Woche gependelt, drei Tage am Bodensee und zwei Arbeitstage in Köln, das war nicht ohne. Es war immer mein Plan, wieder hierher zurückzukommen und da kam eben das interessante Angebot von Bayer. Am Anfang habe ich gezögert, weil das ein ganz anderer Bereich ist. Life Science, Pharma, Agrar, da habe ich wirklich null Expertise. Ich habe darüber im Vorgespräch mit der Arbeitsgruppe bei Bayer diskutiert und dabei hat sich gezeigt, dass das gar kein Problem ist. Die Methoden sind ähnlich: mathematische Optimierung, mathematische Modellierung, künstliche Intelligenz. Die Mathematik beziehungsweise Informatik ist fast universell einsetzbar, da ist die Anwendung dann nicht so wichtig. Klar, man muss die verstehen, und da werde ich sicher zu Anfang des Jahres viel zu kämpfen haben, aber das ist auch spannend. Also ab und zu die Branche wechseln und weiterhin Mathematik machen, das finde ich interessant.
In welchem Bereich werden Sie bei Bayer arbeiten?
Da wird es verschiedene Themen geben, die wurden mir bisher auch nur skizziert. Es wird um mathematische Modellierung gehen, viel um Hybrid-Modellierung.
Und um welche inhaltlichen Fragen?
Ein Beispiel aus dem Bereich Pharma ist die Bioverfügbarkeit. Gegeben ein Wirkstoff in Form einer chemischen Beschreibung oder eines mathematischen Modells – wie gut wird der Wirkstoff vom menschlichen Körper aufgenommen? Wie viel Prozent dieses Wirkstoffs landet nachher in der Blutbahn? Es gibt Wirkstoffe, von denen wünscht man sich, dass ein möglichst hoher Prozentsatz in der Blutbahn landet, und wenn das vielleicht ein belastender Wirkstoff ist, dann möchte man, dass möglichst wenig dort landet. Das ist spannend, weil man verschiedene Arten von Modellen braucht. Man muss den neuen Wirkstoff erstmals modellieren, dann den Blutkreislauf und verschiedene Aufnahmekapazitäten des Körpers. Und dann muss man alles unter einen Hut bekommen. Weil hier mehrere Modelle zusammenkommen, die sonst nichts miteinander zu tun haben, spricht man von Hybrid-Modellierung.
Das klingt für mich so, als ob man jede Menge Fachwissenbenötigt.
Das schon, aber eben aus so vielen verschiedenen Bereichen, da fängt man eben mit jedem neuen Projekt doch immer wieder als Laie an. Das haben mir jedenfalls die neuen Kollegen bei Bayer so erzählt. Man muss sich jedes Mal neu in die Modelle einlesen, vielleicht nicht allgemein in KI, aber doch in die spezielle KI, die an der Stelle gebraucht wird.
Sie werden es dort nicht mehr mit Ingenieuren, sondern mit Medizinern, Physikern und Biologen zu tun haben.
Genau. Klar, bisher habe ich hauptsächlich mit Ingenieuren gearbeitet, aber da waren auch mal Materialwissenschaftler und Physiker dabei. Und jede Fachdisziplin hat ihre eigene Sprache und auch der mathematische Hintergrund ist sehr unterschiedlich. Das kommt als Mathematiker auf einen zu, weil man letztlich eine Hilfswissenschaft vertritt oder Technologien ermöglicht für eine Anwendung – in der Regel in einer anderen Disziplin.
Sie selbst sind über ihre Forschung auf dem Gebiet der Graphentheorie zum Maschinellen und Deep Learning gekommen.
Ja, im Prinzip bin ich aus der Kombinatorik oder der diskreten Mathematik über die Graphentheorie zu den Algorithmen gekommen. Graphen sind ja quasi ein Modell für Netzwerke und damit eigentlich auch irgendwie universell.
Wie finden junge Mathematikerinnen und Mathematiker beruflich am besten einen Einstieg. Der Bereich boomt ja seit ein paar Jahren.Wie kann man sich darauf vorbereiten?
Die meisten Unis haben mittlerweile Vorlesungen zum Thema. Wenn man jetzt ein Mathematikstudium startet, dann sollte man auf jeden Fall Vorlesungen zu den mathematischen Grundlagen der KI, zu Data Science und vielleicht sogar eine zur Programmierung wahrnehmen, weil das die Zukunft ist. Was aber wichtiger ist, ist eine grundsolide mathematische Ausbildung mit Vorlesungen in verschiedenen Bereichen: Numerik kann nicht schaden, Diskrete Mathematik oder Kombinatorik auch nicht. Mir hat auch schon mal die Differentialgeometrie geholfen, obwohl das eigentlich ein sehr theoretisches Gebiet ist. Es gibt diesen Boom momentan, das stimmt, aber es gibt mittlerweile auch viele Leute, die das können. Wenn man dann aber eine solide mathematische Ausbildung hat, bringt man eben mehr mit als jemand mit einem Abschluss in Data Science.
Ich habe gelesen, dass Sie auch Brettspiele designen. Wie sind Sie dazu gekommen, mathematische Problemstellungen in dieser Art umzusetzen?
Ich mache das seit meiner Jugend, damals noch mit Freunden und zunächst waren das Kartenspiele. Dann bin ich nach und nach zu Brettspielen für einen Spieler gekommen und ein Teil der Spiele beschäftigt sich mit Problemen, die man in der Graphentheorie findet. Leben kann man davon nicht, aber als Ausgleich und um dann mal so ein schönes hölzernes Spielbrett in der Hand zu halten, ist es mir die Zeit schon wert. Solche Spiele sind ein Nischenprodukt, aber momentan durchaus ein Renner. Im Moment sitzen ja viele Leute zu Hause und manche haben vielleicht mehr Freizeit als sonst.
Ist das ein Ansporn noch einmal nachzulegen?
Tatsächlich bin ich jetzt wieder dran. Ich war zwei Monate in Kurzarbeit und hatte mehr Zeit als sonst. Ausgangspunkt sind dieses Mal die sogenannten Hamilton-Wege. Es wird ein Spiel für eine Person. Ich habe es wieder nicht geschafft, eines für mehrere Personen zu machen [lacht].
Herr Schaudt, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Das Gespräch führte Kristina Vaillant,
freie Journalistin in Berlin.
www.vaillant-texte.de