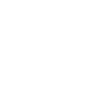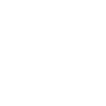Zum Mammografie-Screening für die Brustkrebsfrüherkennung werden alle Frauen in Deutschland im Alter von 50 bis 69 Jahren eingeladen. Etwa die Hälfte kommt zu der Röntgen- Untersuchung, mehr als zwei Millionen jährlich. Über die Auswertung der Untersuchungsergebnisse wacht seit 2005 die Mathematikerin Vanessa Kääb-Sanyal. Dabei interessiert sie sich nicht für einzelne Ergebnisse, sondern für die gesammelten Daten. Sie analysiert Zusammenhänge, zieht daraus Schlüsse über die Qualität des Programms und erkennt Verbesserungsmöglichkeiten. Nur die Frage, ob durch das Screening weniger Frauen an Brustkrebs sterben, lässt sich anhand der Statistiken nicht beantworten.
 Vanessa Kääb-Sanyal. Foto: Kooperationsgemeinschaft Mammografie
Vanessa Kääb-Sanyal. Foto: Kooperationsgemeinschaft Mammografie
Frau Kääb-Sanyal, Sie sind Referentin für Evaluation und Qualitätsmanagement der Kooperationsgemeinschaft Mammografie, die das Screening-Programm in Deutschland organisiert. Was ist genau Ihre Aufgabe?
Ich bin mit einem Team von insgesamt fünf Mitarbeitern, darunter eine weitere Mathematikerin, für die Evaluation und das Qualitätsmanagement verantwortlich. Unsere Hauptaufgabe ist ganz klar die Erstellung der jährlichen Berichte. Das Mammografie-Screening-Programm ist ja ein organisiertes Programm zur Brustkrebsfrüherkennung. Und das heißt: Jede Frau wird schriftlich und mit einem Termin eingeladen, nur Ärzte, die besonders qualifiziert sind, dürfen die Untersuchung durchführen und alle Untersuchungen werden dokumentiert und ausgewertet.
Welche Rolle spielt dafür die Mathematik?
Mathematik steckt da nur zu einem gewissen Teil drin. Uns wird gemeldet, wie viele Untersuchungen stattgefunden haben, wie viele der untersuchten Frauen aufgrund eines Verdachts zu Nachuntersuchungen eingeladen wurden und bei wie vielen von ihnen Brustkrebs diagnostiziert wurde. Wir überprüfen diese Daten, automatisiert über Datenbanken, und ich sorge dafür, dass sie standardisiert ausgewertet werden. Dabei arbeiten wir natürlich mit statistischen Verfahren wie Mittelwerten, Ermittlung des Medians oder Konfidenzintervallen. Mathematik kommt also vor, aber es ist nicht so, dass man dafür ein Mathematik-Studium bräuchte. Sinn und Zweck dieser Berichte ist aber nicht nur die Darstellung der Ergebnisse und der Qualität des Programms, wir lernen auch daraus.
Wie lernen Sie aus den Zahlen?
Bevor das organisierte Mammografie-Screening 2002 eingeführt wurde, war es zum Beispiel so, dass Frauen viel öfter als nötig zu Untersuchungen einbestellt wurden. Heutzutage gibt es einen Grenzwert, und der muss eingehalten werden. Das heißt, maximal fünf Prozent der Frauen, die zur Untersuchung kommen, dürfen aufgrund eines Verdachts zu einer Nachuntersuchung eingeladen werden. Das ist kein willkürlicher Wert, man weiß aus Erfahrung, dass mit diesem Anteil die meisten Verdachtsfälle abgedeckt sind. Der Punkt ist, je mehr ich einbestelle, desto mehr Karzinome kann ich entdecken, aber dieser Effekt ist endlich.
Auch in der öffentlichen Debatte um den Nutzen des Screening-Programms geht es immer wieder um die „richtigen“ Zahlen und deren Bewertung.
Ja, das stimmt, und das hat zwei Seiten. Einerseits haben wir harte Zahlen. Wir wissen sicher, dass wir im Jahr 2011 2,7 Millionen Untersuchungen hatten, und daraus sind eine bestimmte Anzahl von Nachuntersuchungen gefolgt, und am Ende wurden 17 000 Karzinome diagnostiziert. Will man aber bewerten, ob mit dem Screening die Zahl der Todesfälle mit der Ursache Brustkrebs sinkt – und das Mammografie-Screening wurde 2002 vom Bundestag ja mit dem Ziel beschlossen, die Sterblichkeit zu senken – wird es deutlich komplizierter.
Inwiefern?
Die erste Diskussion geht darum, ob man davon sprechen sollte, dass die Sterblichkeit um 20 Prozent sinkt, oder stattdessen lieber absolute Zahlen nennen sollte. Dann sind es nur ein oder zwei Frauen unter Tausend, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums durch das Screening-Programm nicht an Brustkrebs sterben. Ein anderer Teil der Diskussion dreht sich um die Höhe dieser Zahlen:WelcherWert ist korrekt? Die Frage, um wie viel die Mortalität durch das Screening-Programm sinkt, ist in der Tat sehr schwer zu beantworten. Denn wenn ich das Screening erst einmal eingeführt habe und die Mortalität sinkt, woher weiß ich dann, ob das Screening oder eine neue Therapie die Ursache dafür ist?
Sie beschäftigen sich bereits seit dem Abschluss Ihrer Promotion mit der Evaluation und Qualitätssicherung in der Mammografie. Wie sind sie zu diesem Thema gekommen?
Das war Zufall. Ich habe mich nach dem Studium in Konstanz und der Promotion 2003 an der Technischen Universität Berlin auf alles beworben, was interessant klang – ganz gleich, ob es explizit um Mathematik ging oder nicht. Unter anderem habe ich mich auch bei Banken und Unternehmensberatungen umgesehen. Das war aber nicht meine Welt.
Sondern?
Bei meiner ersten Stelle bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns ging es darum, eine konkrete Maßnahme für die systematische Qualitätssicherung in der Mammografie zu stricken. Anhand einer konkreten Fragestellung überlegt man sich, wie man daraus etwas Reales, etwas Umsetzbares mit klaren Vorgaben und Richtlinien machen kann. Das hat mir gut gefallen! Ich fand auch die Verbindung zur Medizin reizvoll.
Sich in medizinische Sachverhalte einzuarbeiten, bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten?
Nein, denn ich arbeite mich nur so weit ein, wie das für das Grundverständnis eines Problems notwendig ist. Ich sortiere alle irrelevanten Informationen aus und abstrahiere dann. Im Prinzip ist das nichts anderes als das, was ich in meiner Doktorarbeit auch gemacht habe: ein Scheduling-Problem als Netzwerk darstellen, das über Knoten und Kanten, Beziehungen und Dauern definiert ist. Und zwar ganz unabhängig davon, welcher Ablauf abgebildet wird, ob es um Gerüstbau, Lagerarbeiten oder den Einsatz von Personal geht. Diese Fähigkeit zur Abstraktion ist tatsächlich auch ein Kern meiner Arbeit hier. Ich versuche die Mediziner zu verstehen und den Inhalt dann so weit zu abstrahieren, dass ich das einem anderen Experten kommunizieren kann. Dann führe ich die jeweiligen Lösungen zusammen.
Ist dieses Vermitteln zwischen den Disziplinen typisch für Ihren Arbeitsalltag?
Am Anfang war es tatsächlich eine meiner Hauptaufgaben, zwischen Informatikern und Medizinern zu vermitteln. Es gibt aber auch immer wieder Schnittstellen zu rechtlichen Fragen. Deshalb arbeite ich auch sehr oft mit Datenschützern zusammen. Zum Beispiel als ich einen neuen Datenfluss konstruiert habe, um die Daten unserer Teilnehmerinnen mit denen der epidemiologischen Krebsregister abzugleichen.
Mit welchen Aufgaben verbringen Sie die meiste Zeit?
Das ist eine gute Frage. Die Hälfte des Tages bin ich mit dem Beantworten von E-Mails beschäftigt: Anfragen von Kollegen, von Krankenkassen, von Journalisten. Entweder ich antworte selbst, oder jemand aus meinem Team formuliert vor und ich schaue dann noch einmal darüber. Derzeit werden die Informationsblätter überarbeitet, die wir den Frauen mitschicken, wenn sie zum Screening eingeladen werden. Da gebe ich auch Input.
Bei Ihnen laufen also viele Fäden zusammen.
Ja, sehr viele.
Gibt es Tätigkeiten, die ihnen besonders am Herzen liegen?
Am liebsten arbeite ich mit den Daten. Wir haben zum Beispiel jetzt in der Evaluation erstmals Daten gesondert für einzelne Altersgruppen. Das bedeutet mehr Informationstiefe, und wir können Unterschiede zwischen den Altersgruppen beobachten. Das diskutieren wir mit Medizinern, aber auch mit Epidemiologen. Noch wissen wir nicht sicher, wie wir diese Daten zu interpretieren haben. Aber das ist ja genau das Spannende.
Im Beruf haben Sie eher wenige Berührungspunkte mit Mathematik, empfinden Sie Mathematik trotzdem auch als Berufung?
Ich liebe Mathematik, und sie ist ein Teil von mir. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch. Aber ich vergleiche das immer mit einem Musikinstrument. Jeder kann sich vielleicht die Akkorde auf einer Gitarre merken und sie auch spielen, aber wer kann den Tönen schon Ausdruck verleihen? So ähnlich ist es mit der Mathematik. Man kann Formeln und Vorgehensweisen trainieren, aber eine bestimmte Art zu denken und Dinge zu durchdringen, das ist der Mathematik eigen. Insofern definiere ich mich über die Mathematik, auch wenn sie nicht mehr viel Anteil an meinem Job hat.
Ist das Gesundheitswesen eine interessante Branche für Mathematik-Absolventen?
Viel Mathematik ist im Gesundheitssektor nicht zu erwarten. Das heißt, man muss sich wirklich entscheiden: Will man Mathematik als Methode anwenden oder die Fähigkeiten, die man im Mathematikstudium lernt als Methodik im Beruf einsetzen. Wer sich für letzteres entscheidet, dem kann ich das Gesundheitswesen nur empfehlen. Es ist ein spannendes Arbeitsgebiet, und ich finde es bis heute sehr befriedigend in einem Sektor zu arbeiten, wo ethische und soziale Fragen hinter den Aufgaben stecken.
Welche Qualifikationen sollten Bewerber mitbringen?
Kommunikation ist sehr wichtig. In der Mathematik werden oft die Ergebnisse sehr hoch gehängt, aber was auch wichtig ist und oft vergessen wird, ist, dass diese Ergebnisse auch schlüssig und allgemein verständlich präsentiert werden müssen. Es wäre gut, wenn das schon im Mathematikstudium trainiert würde. Wo die mathematischen Schwerpunkte liegen, ist dagegen für den Berufseinstieg fast egal.
Das Gespräch führte Kristina Vaillant,
freie Journalistin in Berlin.
www.vaillant-texte.de