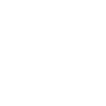Annika Meyer spezialisierte sich bereits während ihres Studiums auf die algebraische Codierungstheorie und promovierte auch auf diesem Gebiet – damals war sie gerade 26 Jahre alt. Anschließend forschte sie knapp zwei Jahre an der Universität und entschied sich schließlich doch gegen eine akademische Karriere. Seit Mai 2011 ist Annika Meyer Mitarbeiterin in der zentralen Forschungsabteilung Corporate Technology des Technologie-Konzerns Siemens in München. Als „Engineer“, so ihre offizielle Berufsbezeichnung, entwickelt sie Siemens-Technologien weiter und hat dabei stets ein Ziel im Blick: Hard- und Software noch sicherer zu machen. Kristina Vaillant, freie Journalistin in Berlin, sprach im Auftrag der DMV mit Annika Meyer.
 Annika Meyer. Foto: privat
Annika Meyer. Foto: privat
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Mathematik zu studieren?
Auf diese Idee kam ich erst gegen Ende der Schulzeit durch Gespräche mit einem Bekannten, einem Mathematik-Dozenten, der mir erklärte, dass Uni-Mathematik etwas ganz anderes ist als Schulmathematik. Er machte mir klar, dass es um Beweise geht und um neue Arten des Denkens. Das hat mich fasziniert, auf diesem Terrain habe ich mich wohlgefühlt. In der Schule dagegen zählte Mathematik nicht zu meinen Lieblingsfächern.
Sie haben sich während Ihres Studiums an der Universität Düsseldorf und später an der Technischen Hochschule Aachen (RWTH) auf die algebraische Codierungstheorie spezialisiert, warum?
Ich hatte nach etwa zwei Jahren Studium den Plan, später einmal im Bereich der Nachrichtenübertragung zu arbeiten. So bin ich auf die algebraische Codierungstheorie gekommen. Die fehlererkennenden und -korrigierenden Codes kommen überall dort zur Anwendung, wo Daten bei der Übertragung oder Speicherung vor Informationsverlust geschützt werden sollen. Meine Diplomarbeit habe ich in diesem Bereich geschrieben und das Thema in meiner Dissertation weiter vertieft.
Und wie ging es nach der Promotion weiter?
Ich hatte immer viel Spaß an Lehre und Forschung. Daher hatte ich zunächst eine akademische Karriere ins Auge gefasst, und weil ich damals noch ziemlich jung war, nahm ich mir die Zeit, diesenWeg auszuprobieren. Meine Doktormutter Gabriele Nebe, Professorin an der RWTH, hat mich dabei unterstützt. Zunächst habe ich knapp zwei Jahre lang auf dem Gebiet der algebraischen Codierungstheorie weitergeforscht, erst an der RWTH, später in Lausanne an der École Polytechnique (EPFL).
Schließlich sind Sie aber doch in die Wirtschaft gewechselt . . .
Ja, ich habe mir gewünscht, stärker anwendungsorientiert und noch mehr im Team zu arbeiten – das waren für mich die wichtigsten Gründe. Außerdem haben mich die Lebensumstände abgeschreckt, die mit dem Postdoc-Dasein verbunden sind: Befristete Verträge und infolgedessen häufiges Umziehen, dazu die Ungewissheit, ob und wann man je eine Professur bekommt.
Waren Sie gut vorbereitet auf Ihren jetzigen Beruf?
Ja, die Zeit an der Uni war eine gute Vorbereitung. Neben den algebraischen und kryptographischen Grundlagen, die ich im Studium erlernt habe, brauche ich in meinem Beruf das analytische Denken, das man in einem Mathematik-Studium intensiv trainiert. Aber es gibt auch Dinge, die man erst später dazulernt.
Wann haben Sie das festgestellt, und um welche Kompetenzen geht es?
Während des Studiums habe ich ein Praktikum im Forschungszentrum Jülich absolviert. Dabei wurde mir klar, wie wichtig es ist, das Programmieren zu beherrschen. Maschinennahe Sprachen, wie sie in der anwendungsbezogenen Forschung benötigt werden, also etwa C, C++ oder Assembler, habe ich im Studium nicht näher kennengelernt. Außerdem habe ich während der Promotion an einem Mentoring-Programm der RWTH Aachen teilgenommen, einem Coaching speziell für Frauen, das den Übergang in den Beruf erleichtern soll. Eine wichtige Einsicht, die ich dort gewonnen habe, ist, dass ich mir ein berufliches Umfeld wünsche, in dem ich viel Entwicklungsspielraum habe und dazulernen kann. Große Unternehmen wie Siemens bieten in dieser Hinsicht gute Möglichkeiten; das war einer der Gründe, warum ich mich dort beworben habe. Und bei Siemens habe ich dann das Programmieren auch tatsächlich gelernt.
Was sind Ihre Aufgaben als „Engineer“ bei Siemens?
Allgemein gesprochen befasse mich mit IT-Security. Das heißt, ich berate Siemens-Abteilungen, in denen Produkte entwickelt werden, zu Fragen rund um das Thema IT-Sicherheit. Dabei kann es sich um so unterschiedliche Produkte handeln wie intelligente Stromnetze – Smart Grids – oder Komponenten für Elektroautos. Aber immer geht es darum, Informationen so aufzubereiten, dass unerwünschte Eingriffe von außen verhindert werden oder sicherzustellen, dass berechtigte Zugriffe auf bestimmte Bereiche beschränkt bleiben. Dafür entwickeln und implementieren wir Sicherheitskonzepte und -technologien.
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Uns stehen pro Woche durchschnittlich ein bis zwei Tage zur Verfügung, an denen wir Forschung betreiben. Das kann bedeuten, dass wir neue Technologien entwickeln oder auch den Stand der Forschung auf einem bestimmten Anwendungsgebiet der IT-Sicherheit erheben und evaluieren, also zum Beispiel prüfen, wie eine Software ein bestimmtes Problem löst. Dafür arbeite ich häufig mit Kollegen zusammen, die zum Teil ebenfalls Mathematiker sind. Manchmal sitzen wir dabei nicht einmal am Rechner, sondern brüten mit Papier und Bleistift über einem Problem.
Und was machen Sie, wenn Sie nicht forschen?
Das sind die Tage, an denen wir „Kundenprojekte“ bearbeiten. Die Kollegen aus anderen Bereichen des Unternehmens, unsere „Kunden“, wenden sich an uns, weil sie für ein bestimmtes Produkt IT-Security benötigen. Wir arbeiten dann eine Bedrohungs- und Risikoanalyse aus und überlegen uns geeignete Maßnahmen, mit denen etwaige Sicherheitslücken geschlossen werden können. Das kann eine eigens entwickelte Technologie aus Hardwareund Software-Komponenten sein oder auch eine vorhandene Technologie, die angepasst wird. Bei diesen Projekten arbeiten wir häufig in größeren Teams, an denen neben Mathematikern zum Beispiel auch Elektrotechniker und Informatiker beteiligt sind.
Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Beruf?
Mir macht genau diese Beratung der „Kunden“ großen Spaß. Da versuche ich – gemeinsam mit meinen Kollegen – ein bestimmtes IT-Security Problem zu erfassen und zu lösen. Jede dieser Fragestellungen ist anders, so dass ich immer etwas Neues dazulerne.
Wie können junge Mathematikerinnen und Mathematiker den Einstieg in dieses Berufsfeld schaffen?
Ich kann nur dazu raten, schon während des Studiums Praktika zu absolvieren oder aber als Werkstudent zu arbeiten. Solche Jobs gibt es auch in der zentralen Forschung bei Siemens. Man sollte allerdings nicht auf eine Stellenausschreibung warten, sondern sich direkt an die Personalabteilung wenden, die leitet die Bewerbungsunterlagen dann schon an die richtige Stelle im Unternehmen weiter. Auch direkte Kontakte zu Mitarbeitern des Unternehmens können bei der Suche nach einem Praktikumsplatz oder einer Stelle helfen. Solche Kontakte bekommt man zum Beispiel über Mentoring-Programme oder auch bei Firmenkontaktmessen.
Ist Mathematik für Sie in erster Linie Beruf – oder auch Berufung?
Ich empfinde Mathematik nicht als Berufung, aber es ist mein Beruf – und es ist ein Beruf, der mir großen Spaß
macht!
Das Gespräch führte Kristina Vaillant,
freie Journalistin in Berlin.
www.vaillant-texte.de