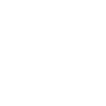Unsere Mathemacherin der Monate Februar und März 2019 ist Anna Maria Hartkopf. Momentan schreibt sie ihre Doktorarbeit in Geometrie am Institut für Mathematik an der Freien Universität Berlin. Aber die Studentin engagiert sich seit je her auch in der Nachwuchsförderung und in der Öffentlichkeitsarbeit. Vor ihrer Dissertation arbeitete sie zum Beispiel drei Jahr lang als Mathematiklehrerin an einer Berliner Gesamtschule und mehrere Jahre lang für das Mathe-Kommunikationsprojekt imaginary.org. Ihre Diplomarbeit schrieb sie über die Simulation von meteorologischen Modellen am Institut für Troposphärenforschung in Leipzig.
 Anna Maria Hartkopf (Foto Janine Kuehn)
Anna Maria Hartkopf (Foto Janine Kuehn)
Frau Hartkopf, Sie machen gerade am Institut für Mathematik an der Freien Universität Berlin Ihre Doktorarbeit. Waren Sie schon immer gut in Mathe? Was war Ihr erstes positives Erlebnis mit der Mathematik, an das Sie sich erinnern?
Hartkopf: Ich bin einfach immer davon ausgegangen, dass ich gut in Mathe bin. Deswegen bin ich nicht verzweifelt, wenn ich etwas nicht gleich verstanden habe, sondern habe die Herausforderung genossen. Ein besonders positives Erlebnis hatte ich in der sechsten Klasse. Wir haben gelernt, dass man nicht nur im Zehner-System rechnen kann, sondern auch in anderen Systemen, zum Beispiel im Hexadezimalsystem. Dort müsste man sich dann nach der Zahl 9 eine neue Ziffer ausdenken, weil die 10 ja schon mit der Wertigkeit von 16 belegt ist, sagte mein Lehrer. Das fand ich faszinierend, dass man in der Mathematik tatsächlich mal etwas Neues und Kreatives hinzufügen durfte.
Was sind Ihre Erfahrungen an der Schule von heute - inzwischen aus der Perspektive der Lehrkraft? Und was hat sie dazu bewogen, dann doch wieder „zurück an die Uni“ zu gehen?
Hartkopf: In der Schule ist die Mathematik leider sehr stark auf das Rechnen und Anwenden von Lösungsalgorithmen ausgerichtet. Es gibt kaum Raum für Kreativität und eigene Ideen. Die Zentralisierung von Leistungsabfragen – in Berlin gibt es zum Beispiel Abschlüsse und damit zentrale Prüfungen nach der neunten und zehnten Klasse und das Abitur – führt dazu, dass die Hauptaufgabe der Lehrerenden darin besteht, die Schülerinnen und Schüler auf diese Prüfungen vorzubereiten. Das ist frustrierend für beide Seiten, weil es den Lehrkräften Autonomie nimmt und die Schülerinnen und Schüler sich dressiert vorkommen. Es ist natürlich wichtig den Grundkanon des Wissens zu standardisieren, aber das darf nicht dazu führen, dass dadurch fast die gesamte Unterrichtszeit bestimmt wird und es kaum Raum zu einem echten Dialog über die Mathematik gibt.
Das ist auch einer der Gründe, warum ich wieder zurück an die Uni gegangen bin. Es war mir wichtig mich wieder kreativer und freier mit Mathematik und ihrer Vermittlung auseinandersetzen zu können.
Gleichwohl kümmern Sie sich auch an der Universität weiter um Schülerinnen und Schüler: Was hat es zum Beispiel mit der Berliner Schülergesellschaft in Mathematik auf sich und was sind Ihre Erfahrungen aus dieser Aktivität?
Hartkopf: Die Mathematische Schülergesellschaft "Leonhard Euler" ist eine Vereinigung in Berlin, die seit fast 50 Jahren mathematisch sehr begabte Schülerinnen und Schüler unterstützt. Nach der sechsten Klasse werden in einem Auswahlverfahren ca. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen einmal pro Woche in die Universitäten zu kommen, um sich dort mit Bereichen der Mathematik auseinanderzusetzten, die in der Schule außen vor gelassen werden (müssen). Ich habe an der Freien Universität eine Gruppe von ca. 20 Schülerinnen und Schülern. Gerade beschäftigen wir uns mit Gruppentheorie. Diese abstrakten Konzepte übersetze ich natürlich ein bisschen auf das Niveau von 13-Jährigen, aber die Mathematik, die dahintersteckt, ist dieselbe. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell die Jugendlichen begreifen und eigene tolle Lösungswege finden.
Und welche Erfahrungen haben Sie mit dem Girls' Day an der Freien Universität gemacht? Die Mathematik ist für viele Schülerinnen und Schüler ja leider immer noch Angstfach...
Hartkopf: Der Girls‘ Day ist ja vor allem dazu gedacht, Schülerinnen an die vermeintlich "männlichen" Fächer heranzuführen. Das ist auch sehr wichtig, denn Mädchen haben oft einfach weniger Selbstvertrauen in ihre analytischen Fähigkeiten. Es gibt Länder, in denen gilt Mathematik als "Mädchenfach" und dort schneiden diese deutlich besser ab, als die Jungen. Es ist also wahnsinnig wichtig den Blick auf das Fach und die eigenen Fähigkeiten zu verändern. Beim Girls‘ Day versuchen wir, genau dies zu tun. Die Kolleginnen aus meiner Arbeitsgruppe und ich wollen den Mädchen eine positive Erfahrung ermöglichen und ihnen an unserem Beispiel zeigen, dass es sie gibt: die Frauen in der Mathematik.
Seit ungefähr einem halben Jahr kann man auf der Website polytopia.eu "sein Polyeder" adoptieren. Was hat es damit auf sich?
Hartkopf: Polyeder sind dreidimensionale Körper, die aus Ecken, geraden Kanten und ebenen Seitenflächen bestehen. Der Würfel und die Pyramide etwa gehören zu dieser Familie. Es gibt unendlich viele Polyeder, aber nur die wenigsten haben einen Namen oder sind jemals als Modell gebaut worden. Sie sind sozusagen verloren in der Sphäre der Abstraktion. Das wollen wir mit unserem Projekt ändern. Auf der Webseite www.polytopia.eu kann man kostenfrei ein Polyeder adoptieren, ihm einen Namen geben und einen zugehörigen Bastelbogen herunterladen. Hat man das Modell gebaut, lädt man ein Foto davon hoch. Auf diese Weise entsteht eine Galerie der Polyeder. Auch hier setzen wir auf das Prinzip, allen Menschen positive Erfahrungen mit Mathematik zu ermöglichen.
Wie wurde das Projekt angenommen und wie viele Polytope wurden schon adoptiert?
Hartkopf: Es gab viele positive Rückmeldungen. Auch die Schulmaterialien, die wir extra für das Projekt entwickelt haben, wurden schon von vielen Lehrerinnen und Lehrern im Unterricht eingesetzt. Bislang wurden schon über 1300 Polyeder adoptiert. Es gibt aber unendlich viele; es braucht also niemand Angst zu haben, dass er oder sie keines mehr abbekommt.