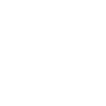Software für die Forschung beim Pharma- und Chemiekonzern Bayer planen und mit einem Team aus Entwicklern, Biologen und Chemikern realisieren – das ist seit drei Jahren das Arbeitsgebiet von Wiebke Höhn, Projektmanagerin am Bayer-Standort Berlin. Das Ergebnis kann eine hoch spezialisierte Anwendung sein, die nur von einer Handvoll Wissenschaftlern genutzt wird oder es entsteht über Jahre eine gesamte Datenplattform. Die mathematische Prozessoptimierung, ihr wissenschaftliches Spezialgebiet, hat die promovierte Mathematikerin für diese Aufgaben in der Industrie hinter sich gelassen.
Frau Höhn, Sie sind als Projektleiterin bei der Bayer Business Services, einem Tochterunternehmen der Bayer AG, tätig, in der alle internen Personal- und IT-Dienstleistungen ausgelagert sind. Mit welchen Aufgaben haben Sie es zu tun?
Ich arbeite in der Abteilung Research & Development-IT. Die hat etwa 200 Mitarbeiter. In der Unterabteilung Early Research bin ich gemeinsam mit zehn Kollegen mit der Entwicklung der Software beschäftigt, die in der Forschung, insbesondere in der ganz frühen Phase der
Ich arbeite in der Abteilung Research & Development-IT. Die hat etwa 200 Mitarbeiter. In der Unterabteilung Early Research bin ich gemeinsam mit zehn Kollegen mit der Entwicklung der Software beschäftigt, die in der Forschung, insbesondere in der ganz frühen Phase der
Forschung, eingesetzt wird. Am Anfang eines Forschungsprozesses stehen Millionen von Substanzen. Die werden im Hochdurchsatzverfahren gescreent, so dass vielleicht noch 100.000 Substanzen bleiben. Die werden weiter runterreduziert, bis am Ende ein paar Kandidaten übrig bleiben. Chemiker sehen sich diese Substanzen dann an und überlegen, wie sie die Strukturen modifizieren können, so dass daraus irgendwann ein Wirkstoff wird. Alle Daten, die während dieses Prozesses generiert werden, werden in einer oder in mehreren Datenbanken gesammelt. Und wir entwickeln Software für diesen Forschungsprozess.Zum Teil sind das Applikationen für nicht mehr als zehn Nutzer.
Um welche Art von Anwendung geht es genau?
Als ich hier vor drei Jahren angefangen habe, da ging es beispielsweise um den Austausch von Substanzen zwischen den Divisionen Pharmaceuticals und Crop Science im Bayer-Konzern.
Als ich hier vor drei Jahren angefangen habe, da ging es beispielsweise um den Austausch von Substanzen zwischen den Divisionen Pharmaceuticals und Crop Science im Bayer-Konzern.
Das sind die Abteilungen für die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten einerseits und von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln für die Landwirtschaft andererseits.
Ja, und die hatten aus historischen Gründen zwei getrennte Lager für Forschungssubstanzen. Weil der Austausch zwischen den beiden Divisionen aber ein komplett neuer Prozess für das Unternehmen war, brauchten wir eine neue Software, die das alles dokumentiert, so dass die rechtliche Seite geklärt ist und die Logistik weiß, wann und wohin sie etwas liefern muss. Danach war ich Projektleiterin für den Aufbau einer großen Plattform für die Analyse von Genomdaten, und seit einem halben Jahr leite ich ein Projekt zur Einführung eines neuen Data Warehouses für Substanzdaten. Hier werden sehr viele chemische und biologische Informationen zu den Struktureigenschaften der Substanzen gesammelt, die beiBayer entwickelt oder eingekauft werden.
Ja, und die hatten aus historischen Gründen zwei getrennte Lager für Forschungssubstanzen. Weil der Austausch zwischen den beiden Divisionen aber ein komplett neuer Prozess für das Unternehmen war, brauchten wir eine neue Software, die das alles dokumentiert, so dass die rechtliche Seite geklärt ist und die Logistik weiß, wann und wohin sie etwas liefern muss. Danach war ich Projektleiterin für den Aufbau einer großen Plattform für die Analyse von Genomdaten, und seit einem halben Jahr leite ich ein Projekt zur Einführung eines neuen Data Warehouses für Substanzdaten. Hier werden sehr viele chemische und biologische Informationen zu den Struktureigenschaften der Substanzen gesammelt, die beiBayer entwickelt oder eingekauft werden.
Und wer nutzt diese Software-Lösungen?
Unter anderem die Biologen, die die Tests entwickeln, die mit den Substanzen durchführt werden, und die Chemiker, die an den molekularen Strukturen arbeiten. Die Software hat viele unterschiedliche Funktionalitäten, die von den verschiedenen Gruppen genutzt werden. Jede Gruppe von Nutzern schaut auf den Teil der Daten, den sie braucht.
Unter anderem die Biologen, die die Tests entwickeln, die mit den Substanzen durchführt werden, und die Chemiker, die an den molekularen Strukturen arbeiten. Die Software hat viele unterschiedliche Funktionalitäten, die von den verschiedenen Gruppen genutzt werden. Jede Gruppe von Nutzern schaut auf den Teil der Daten, den sie braucht.
Wie läuft so ein Projekt ab?
Das hängt von der Größe ab. Wenn die Projekte kleiner sind, ist das quasi eine One-Man-Show. Man versucht zunächst zu verstehen, was die Nutzer brauchen. Wenn man das verstanden hat, macht man einen Entwurf. Ich male dann vielleicht ein kleines Bildchen, wie so ein Screen aussehen könnte, mit ein paar Buttons darauf. Diese Skizze kommuniziere ich an die Entwickler, die wiederum schicken ihren Entwurf zurück, der wird getestet und wiederum mit den Nutzern besprochen, und so weiter.
Das hängt von der Größe ab. Wenn die Projekte kleiner sind, ist das quasi eine One-Man-Show. Man versucht zunächst zu verstehen, was die Nutzer brauchen. Wenn man das verstanden hat, macht man einen Entwurf. Ich male dann vielleicht ein kleines Bildchen, wie so ein Screen aussehen könnte, mit ein paar Buttons darauf. Diese Skizze kommuniziere ich an die Entwickler, die wiederum schicken ihren Entwurf zurück, der wird getestet und wiederum mit den Nutzern besprochen, und so weiter.
Und bei größeren Projekten wie dem Aufbau einer Datenplattform für Forschungssubstanzen?
Da gibt es sehr viel mehr übergeordnete Themen. Als Projektleiterin versuche ich, die inhaltlichen Fragen der verschiedenen Workstreams zusammenzufassen. Ich sorge zum Beispiel dafür, dass die Inhalte hinreichend priorisiert sind und ich organisiere Workshops.
Da gibt es sehr viel mehr übergeordnete Themen. Als Projektleiterin versuche ich, die inhaltlichen Fragen der verschiedenen Workstreams zusammenzufassen. Ich sorge zum Beispiel dafür, dass die Inhalte hinreichend priorisiert sind und ich organisiere Workshops.
Wie groß ist ihr Team?
Neben mir gibt es einen weiteren Projektleiter auf der Forschungsseite. Ich selbst bin für die IT-Seite dabei. Und wir haben, weil es eine sehr umfassende Applikation für viele Wissenschaftler in verschiedenen Unternehmensbereichen ist, auch pro Forschungsstandort und Disziplin eine Person im Team. Das sind Chemiker, Biochemiker
Neben mir gibt es einen weiteren Projektleiter auf der Forschungsseite. Ich selbst bin für die IT-Seite dabei. Und wir haben, weil es eine sehr umfassende Applikation für viele Wissenschaftler in verschiedenen Unternehmensbereichen ist, auch pro Forschungsstandort und Disziplin eine Person im Team. Das sind Chemiker, Biochemiker
und Biologen aus Monheim, Frankfurt und Lyon. Darüber hinaus geben uns einige Wissenschaftler regelmäßig Feedback zu dem, was wir entwickeln. Und dann gehören natürlich auch noch die IT-Teams in Leverkusen und Berlin mit dazu, die die genauen Anforderungen mit den Wissenschaftlern erarbeiten und danach umsetzen. Mit all diesen Leuten sind wir in untergeordneten Workstreams organisiert. Daneben gibt es auch noch einen Change-Management-Workstream, weil die Software im Bereich Crop Science neu eingeführt werden soll.
Das klingt nach einem Team so groß wie eine Schulklasse.
Ich glaube, wir sind 33.
Ich glaube, wir sind 33.
Wie läuft die Kommunikation bei so vielen Beteiligten an verschiedenen Standorten?
Ich bin hier am Standort Berlin die Einzige. Wir haben viele Skype-Konferenzen, aber es ist auch wichtig, dass ich vor Ort bei den Workshops und Meetings meine Kollegen treffe, denn viele Dinge passieren eben erst nach dem Meeting, auf dem Weg zur Kaffeemaschine.
Ich bin hier am Standort Berlin die Einzige. Wir haben viele Skype-Konferenzen, aber es ist auch wichtig, dass ich vor Ort bei den Workshops und Meetings meine Kollegen treffe, denn viele Dinge passieren eben erst nach dem Meeting, auf dem Weg zur Kaffeemaschine.
Ihr Arbeitsalltag besteht also in erster Linie aus Management-Aufgaben.
Je größer die Projekte werden, desto mehr Management gehört dazu.
Je größer die Projekte werden, desto mehr Management gehört dazu.
Arbeiten Sie sich für diese Projekte in die biologisch-chemischen Zusammenhänge ein?
Ich versuche, so viel mitzunehmen, wie ich kann. Es reicht Wissenschaftler mit welchen Daten arbeiten. Mir hilft dabei, selber mal in der Wissenschaft tätig gewesen zu sein, auch wenn meine Forschung im Bereich mathematische Optimierung etwas komplett anderes war. Der „Stallgeruch“ spielt, glaube ich, eine Rolle für die gegenseitige Akzeptanz.
Ich versuche, so viel mitzunehmen, wie ich kann. Es reicht Wissenschaftler mit welchen Daten arbeiten. Mir hilft dabei, selber mal in der Wissenschaft tätig gewesen zu sein, auch wenn meine Forschung im Bereich mathematische Optimierung etwas komplett anderes war. Der „Stallgeruch“ spielt, glaube ich, eine Rolle für die gegenseitige Akzeptanz.
Gibt es Aufgaben, die Ihnen besonders liegen?
Was mir sehr viel Spaß macht, ist, ein neues Projekt aufzubauen. Dann überlege ich mir: Wer ist beteiligt, was haben wir für Inhalte zu diskutieren, an welchem Standort sitzen die Leute, was sind das für Charaktere? Und dann denke ich darüber nach, wie man die Projektstruktur aufbaut: Wie organisiert man sich, was hat man für Meetings, wer spricht wann mit wem, wer hat welche Rollen und Verantwortlichkeiten? Das Projekt sollte so aufgebaut sein, dass man gut arbeiten kann und dass es allen Spaß macht. Wenn es dann am Ende klappt, ist es immer schön, aber es ist auch oft ein langer Weg.
Was mir sehr viel Spaß macht, ist, ein neues Projekt aufzubauen. Dann überlege ich mir: Wer ist beteiligt, was haben wir für Inhalte zu diskutieren, an welchem Standort sitzen die Leute, was sind das für Charaktere? Und dann denke ich darüber nach, wie man die Projektstruktur aufbaut: Wie organisiert man sich, was hat man für Meetings, wer spricht wann mit wem, wer hat welche Rollen und Verantwortlichkeiten? Das Projekt sollte so aufgebaut sein, dass man gut arbeiten kann und dass es allen Spaß macht. Wenn es dann am Ende klappt, ist es immer schön, aber es ist auch oft ein langer Weg.
Man könnte also sagen, Sie optimieren zwar weiterhin Prozesse, aber es geht nicht um Prozessoptimierung im mathematischen Sinne.
Naja, es geht hier eher um einen Metaprozess und das hat natürlich mit der mathematischen Prozessoptimierung gar nichts zu tun.
Naja, es geht hier eher um einen Metaprozess und das hat natürlich mit der mathematischen Prozessoptimierung gar nichts zu tun.
Dabei sind Sie eigentlich gerade deshalb zu Bayer gekommen.
Das stimmt. Vor drei Jahren, als mein Arbeitsvertrag als Post-doc in der Arbeitsgruppe Kombinatorische Optimierung und Algorithmen an der TU Berlin noch ein halbes Jahr lief, war ich in Sorge, ob ich noch einen Job finde, den ich spannend finde. Und dann stieß ich auf die Ausschreibung für diese Stelle: Naturwissenschaftler im Bereich Forschungs-IT und Prozessoptimierung gesucht. Ich dachte sofort, Prozessoptimierung, das kann ich, das ist meine Stelle. Im Bewerbungsgespräch habe ich hochmotiviert erzählt, was ich alles optimiert habe. Meine Gesprächspartner bei Bayer nickten zustimmend, sagten, das sei sehr spannend. Bei Bayer gebe es auch Prozesse und Software, um diese Prozesse zu optimieren, aber das sei keine mathematische Prozessoptimierung.
Das stimmt. Vor drei Jahren, als mein Arbeitsvertrag als Post-doc in der Arbeitsgruppe Kombinatorische Optimierung und Algorithmen an der TU Berlin noch ein halbes Jahr lief, war ich in Sorge, ob ich noch einen Job finde, den ich spannend finde. Und dann stieß ich auf die Ausschreibung für diese Stelle: Naturwissenschaftler im Bereich Forschungs-IT und Prozessoptimierung gesucht. Ich dachte sofort, Prozessoptimierung, das kann ich, das ist meine Stelle. Im Bewerbungsgespräch habe ich hochmotiviert erzählt, was ich alles optimiert habe. Meine Gesprächspartner bei Bayer nickten zustimmend, sagten, das sei sehr spannend. Bei Bayer gebe es auch Prozesse und Software, um diese Prozesse zu optimieren, aber das sei keine mathematische Prozessoptimierung.
Davon haben Sie sich nicht abschrecken lassen.
Nein, es war auch eher eine lustige Gesprächssituation. Es hieß dann, mathematische Prozessoptimierung haben wir hier nicht, aber wollen Sie nicht trotzdem kommen. Die Aufgaben haben mich gereizt, deshalb habe ich die Mathematik komplett hinter mir gelassen.
Nein, es war auch eher eine lustige Gesprächssituation. Es hieß dann, mathematische Prozessoptimierung haben wir hier nicht, aber wollen Sie nicht trotzdem kommen. Die Aufgaben haben mich gereizt, deshalb habe ich die Mathematik komplett hinter mir gelassen.
Ihre Bewerbung beruhte also eigentlich auf einem Missverständnis.
Ja, aber es hat sich im Nachhinein als ein sehr glückliches herausgestellt (lacht).
Ja, aber es hat sich im Nachhinein als ein sehr glückliches herausgestellt (lacht).
Sie hatten sich in ihrer Diplomarbeit, mit der Sie ihr Mathematik-Studium 2007 an der TU Berlin abgeschlossen haben, mit Scheduling-Problemen befasst und in ihrer anschließenden Promotion ebenfalls.
Ja, das stimmt, da ging es um Prozessoptimierung in diversen Bereichen: Ablaufplanung in der Stahlproduktion, Abfüllplanung in der Molkereiwirtschaft, die Produktion bei einem Bremsen-Hersteller. Aber eigentlich sind die mathematischen Probleme, die dahinter liegen, strukturell recht ähnlich.
Ja, das stimmt, da ging es um Prozessoptimierung in diversen Bereichen: Ablaufplanung in der Stahlproduktion, Abfüllplanung in der Molkereiwirtschaft, die Produktion bei einem Bremsen-Hersteller. Aber eigentlich sind die mathematischen Probleme, die dahinter liegen, strukturell recht ähnlich.
Inwieweit profitieren Sie heute von ihrer wissenschaftlichen Ausbildung und Tätigkeit in der Mathematik?
Je größer ein Projekt ist, desto komplexer und desto mehr
Je größer ein Projekt ist, desto komplexer und desto mehr
Aspekte muss man unter einen Hut bringen und priorisieren. Wenn man da ein bisschen Struktur im Denken hat, dann hilft das. Insofern glaube ich schon, dass man sehr viel aus dem Mathestudium mitnimmt.
Welche Tipps würden Sie Absolventen für den Übergang ins Arbeitsleben geben?
Ich finde, es bringt nichts zu sagen, man muss jetzt dieses oder jenes machen und dann klappt es. Das wichtigste ist herauszufinden, was man gerne macht, was man gut kann. Für die einen ist die Uni mit ihren Freiheiten genau das richtige, und die bleiben dann liebend gerne bis zur
Ich finde, es bringt nichts zu sagen, man muss jetzt dieses oder jenes machen und dann klappt es. Das wichtigste ist herauszufinden, was man gerne macht, was man gut kann. Für die einen ist die Uni mit ihren Freiheiten genau das richtige, und die bleiben dann liebend gerne bis zur
Pensionierung. Andere brauchen etwas Konkretes, etwas zum Anfassen, die gehen dann vielleicht eher in die Wirtschaft. Wenn ich weiß, was mir liegt, dann kann ich auch zielgerichtet suchen.
Und wo lohnt es sich zu suchen?
Ich würde mich erst bei Leuten erkundigen, die ich aus dem Studium oder aus der Arbeitsgruppe kenne, bei Kollegen von Kollegen nachfragen, was die so machen. Auch Jobbörsen sind gar nicht so schlecht. Es kann aber auch lohnenswert sein, sich einfach zu bewerben und anzufangen. Gerade bei großen Firmen wie Bayer sieht man
Ich würde mich erst bei Leuten erkundigen, die ich aus dem Studium oder aus der Arbeitsgruppe kenne, bei Kollegen von Kollegen nachfragen, was die so machen. Auch Jobbörsen sind gar nicht so schlecht. Es kann aber auch lohnenswert sein, sich einfach zu bewerben und anzufangen. Gerade bei großen Firmen wie Bayer sieht man
von außen nicht genau, welche Tätigkeit sich hinter einer Job-Beschreibung verbirgt. Wenn man aber erst mal in so einer Firma drin ist und merkt, der Job liegt mir nicht, dann kann man immer noch einen spannenderen Job in einer anderen Abteilung finden. Das sind Möglichkeiten, die hat man nicht, wenn man von außen kommt, weil nicht alle Stellen extern ausgeschrieben werden. Gerade bei großen Firmen lohnt es sich, einfach anzufangen – vorausgesetzt natürlich, man findet die Firma interessant.
Kristina Vaillant ist freie Journalistin in Berlin und arbeitet regelmäßig für das Medienbüro der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.
Foto: Christoph Eyrich