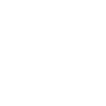Stefano Cardanobile ist viel in Europa herumgekommen: Als gebürtiger Italiener kam er während des Mathematikstudiums von Bari nach Tübingen, schrieb seine Doktorarbeit an der Universität Ulm und schloss einen Postdoc an der Universität Freiburg an, bevor er schließlich als leitender Ingenieur und später Teamleiter bei Bosch in Reutlingen arbeitete. Seit Anfang des Jahres ist er Systems Engineer bei Meta (ehemals Facebook) in Zürich.
 Stefano Cardanobile. Foto: privat
Stefano Cardanobile. Foto: privat
Die Vision von Meta ist das Metaversum, eineWelt, in der die Grenzen von echter und virtuellerWelt immer weiter verschwimmen. Kannst Du uns einen kleinen Einblick in das Metaversum geben?
Die Idee ist eine Welt mit betretbaren virtuellen Räumlichkeiten, in denen mehr menschliche Interaktion stattfinden kann. Statt wie wir jetzt gerade über Video zu telefonieren, könnten wir dann mit Hilfe von „virtual“ beziehungsweise „augmented reality“ quasi nebeneinander sitzen und eine direktere Verbindung zueinander haben. Wir hätten viel mehr als jetzt das Gefühl, im gleichen Raum zu sitzen. Das Metaversum ist vor allem etwas ganz Neues, und es ist noch nicht so ganz klar, was es werden wird. Meta entwickelt aber auch andere Produkte, die heute schon erhältlich sind, etwa etwa verbesserte Webcams. Zum Beispiel ist der „Portal“ ein Produkt, das eine bessere Erfahrung bei Videokonferenzen ermöglichen soll. Der Portal hat eine Breitwinkelkamera, die automatisch zoomen und Dir folgen kann, wenn Du Dich bewegst. Es ist schwer zu beschreiben warum, aber tatsächlich ist es schöner, man fühlt sich verbundener und eher so, als wäre die andere Person im gleichen Raum.
Du bist jetzt ganz nah dran an der Entwicklung des Metaversums. In welchem Bereich bist Du tätig?
Ich bin an der Entwicklung der Virtual-Reality-Brille „Oculus Quest“ beteiligt.
Was steckt dort für Mathematik drin?
Sowohl jetzt bei Meta als auch vorher bei Bosch hatte ich sehr viel mit Linearer Algebra zu tun. Ich programmiere nicht oder mache Hardware-Design, sondern beschäftige mich mit Systemintegration, das ist viel mehr Konzeptarbeit. Dass Lineare Algebra so ein wichtiger Baustein der heutigen Technik ist, das ist schon überraschend, gerade wenn man mal Funktionalanalysis gemacht hat, also im Grunde unendlichdimensionale Lineare Algebra. Dann kommt man in die Industrie, und dort wird entweder mit Computer Vision wie bei Meta gearbeitet oder mit reduzierten Ordnungsmodellen wie bei Bosch und das ist eben Lineare Algebra. Außerdem spielt Statistik eine wichtige Rolle.
Man bewegt sich also eher an der mathematischen Basis. Arbeiten viele Mathematiker bei Meta und Bosch?
Nein. Kollegen, die Mathe studiert haben, habe ich immer wenige gehabt. Wenn überhaupt, dann im Data-Science- Bereich. Wobei ich nicht weiß, ob die Mathematiker unterrepräsentiert waren oder es einfach weniger Mathematiker als Physiker oder Ingenieure gibt. In Ulm, wo ich promoviert habe, sind viele in die Finanzbranche gegangen oder zu einer Beratung. Das scheint mir der typischere berufliche Weg von Mathematikern zu sein. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum man in Tech-Unternehmen weniger Mathematiker sieht.
Was sollte man abgesehen von gewissen mathematischen Fähigkeiten mitbringen, um bei Meta zu arbeiten?
Meta ist eine große Firma, dort werden ganz unterschiedliche Dinge gemacht, und der Auswahlprozess ist relativ kompliziert. Man sollte programmieren können und ein relativ breites technisches Verständnis haben. Man sollte auch wissen, was technologisch möglich ist und was nicht. Da tun sich Mathematiker oft schwer. Physiker, die auch viele Experimente machen, haben da normalerweise ein bisschen mehr Affinität zu Technik.
Inwiefern würdest Du sagen bereitet das Mathestudium auf das Berufsleben vor?
Ich hatte nie so viele Kollegen aus der Mathematik, aber aufgefallen ist mir, dass Mathematiker eine gewisse neutrale Akzeptanz von Realität mitbringen. Wir werden als Mathematiker trainiert, Axiome hinzuschreiben, und was kommt, das kommt. Wenn ein schönes oder überraschendes Theorem kommt, dann ist das so. Wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann ist es eben so. Ich stelle meine Spielregeln auf und dann muss ich gucken, was sich daraus ergibt. Alle Mathematiker, die ich im beruflichen Umfeld kennengelernt habe, hatten immer diesen distanzierten Blick zur Realität im Unternehmen. Sie haben normalerweise sehr gefasst reagiert, wenn merkwürdige Probleme aufgetaucht sind. Den Kollegen, die Physik oder Ingenieurwissenschaften studiert hatten, bereiteten solche Überraschungen oft mehr Schwierigkeiten. Das hätte ich nicht erwartet.
Das heißt, die Beschäftigung mit schön merkwürdigen Gegenbeispielen und allen möglichen Sonderfällen zahlt sich am Ende tatsächlich aus?
Ja, wobei ich das nicht als technische Fähigkeit sehen würde, sondern eher als Lebenseinstellung. Ich weiß aber nicht, ob einen das Mathematikstudium darauf vorbereitet oder Leute mit dieser Lebenseinstellung sich für ein Mathestudium entscheiden und später diese Art von Problemen in ihrem Unternehmen annehmen.
Auf was hat Dich das Studium der Mathematik nicht vorbereitet?
Ein gewisses Problem für mich war Kommunikation, die musste ich tatsächlich lernen. In einem Großkonzern mit hunderten Abteilungen und tiefen Hierarchien kann die Kommunikation leicht ausarten, und das ist manchmal überfordernd.
Du hast mit Bosch und Meta zwei Großkonzerne von innen kennengelernt. Kannst Du Unterschiede und Gemeinsamkeiten feststellen, beispielsweise in der Unternehmenskultur?
Definitiv. Bosch ist ein altes, traditionsreiches Unternehmen in einem fertigungsorientierten Bereich. Dort werden Dinge hergestellt wie zum Beispiel Sicherheitssysteme für die Automobilindustrie. Wenn irgendein Sensor kaputt ist, dann können Leute sterben und das muss natürlich unbedingt vermieden werden. Deswegen ist das ganze Unternehmen sehr konservativ. Man geht sehr sorgfältig mit Dingen um, damit nichts Schlimmes passiert. Außerdem ist Bosch ein deutsches Unternehmen, und Deutsche sind sehr vorsichtige Menschen – das sage ich als gebürtiger Italiener. Facebook, also Meta, ist ein Unternehmen von der amerikanischen Westküste und dort wird Software entwickelt. Das ist genau das Gegenteil. Es ist alles sehr schnell, Geschwindigkeit ist wichtiger als Richtigkeit, es gibt also ein anderes Trade-off. Was am Ende zählt, ist aber die Kultur in dem kleinen Team, in dem man arbeitet. Im Bereich Forschung und Entwicklung arbeiten immer sehr weltoffene und gebildete Menschen, da merke ich auf der Teamebene wenig Unterschied. Ich hatte das Glück, immer in guten Teams zu arbeiten, wo es keine großen Probleme gab.
Facebook steht in den Medien regelmäßig in der Kritik wegen seines lockeren Umgangs mit Nutzerdaten, seiner Monopolstellung und der Verbreitung von Fake News bis hin zur Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahl 2016. Wird so etwas bei euch im Team thematisiert?
Dafür bin ich noch zu kurz dabei. Von den fünf Monaten war ich zwei im Homeoffice und die letzten drei Monate war hauptsächlich der Ukraine-Krieg ein Thema. Von daher kann ich da nichts Sinnvolles zu sagen, selbst wenn ich dürfte. Für solche Fragen gibt es eine Pressestelle, da wird dann alles erklärt, was man erklären kann.
War es für Dich persönlich ein Punkt?
Das ist glaube ich ein Kulturunterschied. Ich habe persönlich kein großes Problem mit meinen Daten, das ist eine sehr kontinentaleuropäische Sorge.
Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Dir aus, sofern es diesen gibt?
Auch dafür bin ich noch zu kurz bei Meta dabei, momentan ist alles noch sehr dynamisch. Daher ist vielleicht interessanter, wenn ich von Bosch erzähle, wo ich viele Jahre gearbeitet habe. Dort hatte ich im Grunde zwei komplett unterschiedliche Stellen. Lange war ich Ingenieur und habe Sensoren designt. Ein Teil meines Arbeitstags war immer irgendeine Art von Programmieren im Scientific Computing Bereich. Zum Beispiel ging es darum, wie ein Sensor sich in ganz bestimmten Situationen verhalten wird, oder ich habe an einer Statistik für die Fertigung gearbeitet. Ein weiterer großer Teil war die Abstimmung mit anderen Kollegen aus dem Projekt. Wir haben in einem sehr interdisziplinären Team aus Mathematikern, Chemiker, Projektleitern zusammengearbeitet, und da hat die gegenseitige Verständigung viel Zeit gebraucht. Wenn zum Beispiel der Chemiker mit einem Plasmaphysik-Problem aus der Fertigung gekommen ist, musste er erstmal erklären, was das Problem ist und welche Auswirkungen es für uns hat. Nach meinem internen Wechsel war ich in der Fertigungskoordination. Dort hatte ich eine Führungsposition und das war ein bisschen mehr Diplomatie und Planung, da hatte ich tatsächlich keinen typischen Tag. Ein großer Anteil war hier Kommunikation. Mein Team hat Data Engineering für die Werke gemacht, für die wir mehr oder weniger Dienstleister waren. Das war sehr spannend, viel Abstimmung mit den verschiedenen Leuten aus den Werken, also mit den internen Kunden.
Bei Bosch hast Du zur Entwicklung sogenannter MEMSSensoren beigetragen. Was hat es mit diesen auf sich?
Du hast ein Smartphone, oder? Wenn Du das Smartphone drehst, dann dreht sich das Bild. Das funktioniert mit Hilfe eines Beschleunigungssensors, der ins Smartphone eingebaut ist und merkt, wie Du das Smartphone hältst. Er merkt, ob er nach unten oder nach rechts gezogen wird, also, in welche Richtung die Gravitationskraft zeigt. MEMS steht für „mikroelektromechanische Systeme“, das sind ganz winzige Objekte. Ein Drehdatensensor ist ungefähr zwei Millimeter mal zwei Millimeter groß und ist eine Struktur aus Silizium, die sehr verwinkelt und kompliziert aussieht. Diese Struktur kann sich bewegen. Die Bewegung wird dann elektromagnetisch erfasst, und so kann man herausfinden, welche Kraft auf den Sensor wirkt, welche Drehrate, welcher Druck und so weiter. Solche Sensoren gibt es in Smartphones und ähnlichen Geräten, aber auch im Auto. Ein Auto hat ein Elektronisches Stabilitätsprogramm, kurz ESP. Das System merkt, wenn das Auto anfängt zu schleudern, und bremst entsprechend. Irgendwo im Auto ist nämlich ein MEMS vergraben, das registriert, ob das Auto sich gerade zu schnell dreht, und dann kann die Autosteuerung entsprechend entgegenwirken. So etwas habe ich sieben Jahre lang gemacht.
Wie konntest Du hier als Mathematiker genauer mitwirken?
Es geht ja um Teile, die sich bewegen können müssen. Daher geht es um Gleichungen aus der Strukturmechanik, und die haben Moden, also Eigenvektoren. Die Bewegungen müssen so ausgerichtet sein, dass diese Moden zum Beispiel auf die Gravitationskraft reagieren. Der Beschleunigungssensor muss also eine Mode haben, die auf diese Kraft reagiert, damit er sich bewegt, wenn Beschleunigung vorhanden ist. Nun gibt es aber unendlich viele linear unabhängige Eigenvektoren, man hat also unendlichdimensionale Gleichungen und muss diese Modelle reduzieren. So kommt man auf reduzierte Ordnungsmodelle, sozusagen Projektionen auf endlichdimensionale Räume.
Da hört man die Lineare Algebra durchklingen.
Ja, wobei die Gleichungen der Strukturmechanik eigentlich nichtlinear sind. In der Näherung für kleine Auslenkungen sind sie linear, aber wenn die Auslenkungen groß werden, sind sie nichtlinear. Bei nichtlinearen Gleichungen ändern sich die Eigenvektoren mit der Auslenkung. Man kann also nicht so einfach auf die Eigenräume projizieren, weil die Eigenräume nicht stabil sind. Wie löst man das? Über so etwas muss man nachdenken. Teile vondieser Theorie habe ich implementiert oder erweitert.
Diese Theorie entscheidet also, wie der MEMS-Sensor aussieht und wie er ausgerichtet ist?
Ja. Die MEMS-Sensoren besitzen viele filigrane Strukturen, sagen wir mal Beinchen, aus Silizium und man muss entscheiden, wie diese ausgerichtet sind, wie dick oder dünn sie sein sollen und wie viele von diesen Beinchen man braucht.
Und dann gibt es ganz viele Tests der Hardware, ob die Berechnungen tatsächlich gestimmt haben?
Genau. Erstmal werden hunderttausende von den Sensoren gefertigt und statistisch ausgewertet.
Hattet ihr mal den Fall, dass eure Theorie falsch war und sich das beim Sensor ausgewirkt hat?
Natürlich ist jede Theorie falsch. Newtonsche Mechanik ist falsch, aber Spezielle Relativitätstheorie ist auch falsch. Die Frage war immer, wie falsch liegen wir, und ist das nur akademisch relevant oder führt es dazu, dass wir ein bisschen umbauen müssen, oder ist es sogar so schlimm, dass wir tatsächlich etwas Grundlegendes ändern müssen, weil wir etwas Grundsätzliches nicht verstanden haben.
Du hast bei Bosch zu nichtlinearer Mechanik geforscht, eine ganze Reihe von Papers veröffentlicht und Studenten betreut. Das klingt nach einer Laufbahn in der Wissenschaft. Wo sind Unterschiede zur akademischen Laufbahn an einer Hochschule?
Zunächst einmal in der Menge. In einer Forschungs- und Entwicklungs-Abteilung kann man ein bisschen so etwas machen, aber nicht in dem Umfang wie an der Uni. Ich habe in den zehn Jahren bei Bosch einen Doktoranden, ein oder zwei Masterarbeiten und studentische Hilfskräfte betreut. Das andere ist, dass man weniger Freiheit bei der Themenwahl hat. Eine Industriepromotion zum Beispiel soll natürlich wissenschaftlich wertvoll sein, aber man hat eine genau definierte Fragestellung, für die das Unternehmen die Antwort will. Zum Beispiel gibt es ein Problem mit mechanischen Nichtlinearitäten und da muss eine Lösung her. Das ist an der Uni normalerweise weniger vorgegeben. Während meiner Promotionsphase an der Universität Ulm wollte ich zunächst etwas mit Netzwerken in Richtung computational neuroscience machen. Nach sechs Monaten haben wir entdeckt, dass sich unsere Mathematik total gut für ein Problem aus der theoretischen Physik eignet, und ich habe ohne mit der Wimper zu zucken einfach umgeschwenkt. Das kann man bei einer Industriepromotion nicht machen.
Würdest Du sagen, für jemanden, der gerne in derWissenschaft bleiben würde, aber vor den Bedingungen dort zurückschreckt, ist die Industrie eine gute Alternative?
Wenn man wirklich motiviert ist, dann bekommt man das vielleicht hin. Aber in einer großen Gruppe mit zwei Dutzend Leuten gibt es vielleicht ein bis zwei Leute, die Doktoranden betreuen, der Anteil ist also nicht groß und man muss es wirklich wollen. Wenn man eigentlich in der Wissenschaft bleiben möchte und in die Industrie geht, kann es passieren, dass man nach ein paar Jahren wieder zurückwechselt. Wobei das natürlich auf den Bereich ankommt. Der Bereich bei Bosch, in dem ich Entwicklung gemacht habe, war sehr wissenschaftsorientiert. Wir haben tatsächlich an der Grenze von dem gearbeitet, was die Menschheit weiß. Es gibt also auch in der Industrie Bereiche, in denen man wissenschaftlich arbeiten muss, aber man muss wissen wo.
Von der Berufsbezeichnung her bist Du heute Ingenieur. Fühlst Du Dich denn noch als Mathematiker?
Ja, definitiv. Erstmal weil ich über viele technische Probleme nicht so viel weiß, ich sie auch nicht so schnell begreife und mich nicht so brennend dafür interessiere wie Leute, die das studiert haben. Das sind die negativen Seiten. Aber das Positive ist, dass ich abstrakte Dinge sofort verstehe. Oder dass ich in statistische Fallen nicht so leicht reintappe. Ich merke, dass es da einen Unterschied gibt. Ich weiß nicht, ob ich ein typischer Mathematiker bin, aber ich fühle mich wie einer. Ich habe mich auch immer gerne mit Geisteswissenschaften beschäftigt, ich war auf einem geisteswissenschaftlichen Gymnasium und interessiere mich seit jeher für Philosophie, Literatur und Musik. Diese schöngeistige Seite erscheint mir typisch für Mathematiker. Noch eine kleine Anekdote aus meinem Studium: Ich habe zunächst ein Jahr Maschinenbau studiert und in den ersten zwei Studienjahren waren die Kursinhalte für Mathematiker, Physiker und Ingenieure gleich, ich habe ja in Italien studiert. In einer der ersten Vorlesungen „Analysis I für Maschinenbauer“ kam die Professoressa rein und hat die natürlichen Zahlen nach Peano eingeführt. 298 Leute im Hörsaal haben geschimpft, nur ein Kommilitone und ich waren sofort begeistert. An dem Tag habe ich mich entschlossen, dass ich zur Mathematik wechseln werde, weil das ist, was ich im Leben machen will.
Du bist also von ganzem Herzen Mathematiker.
Ja, und ich bin dankbar, dass ich Mathematik studiert habe. Sie ist ein bisschen abstrakt und erfordert manchmal viel Arbeit. Aber heute merke ich tatsächlich, dass man sich leichter mit einem Karrierewechsel tut. Ich habe sehr unterschiedliche Sachen gemacht in Promotion und Postdoc, hatte drei verschiedene Stellen und habe immer sehr einfach wechseln können zwischen unterschiedlichen Bereichen. Durch die Beschäftigung mit der Mathematik bekommt man mit, wie man quantitatives Wissen generell aufbaut. Man bekommt so eine Art Universalwerkzeug an die Hand.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führte Kari Küster.