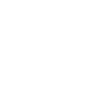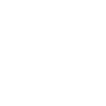Jens Hillmann ist beides – studierter Mathematiker und leidenschaftlicher Sportler. In seinem Beruf als IT-Berater und Performance Analyst verbindet er den Sport mit seiner wissenschaftlichen Ausbildung, gleichzeitig ist er Vermittler zwischen der Welt des Sports und der ITTechnologie. In den angelsächsischen Ländern ist die Datenanalyse als Instrument, um Leistungen im Sport zu evaluieren und zu verbessern, bereits etabliert, in Deutschland formiert sich diese Branche gerade erst. Jens Hillmann bietet sie viel Raum zum Experimentieren.
 Jens Hillmann. Foto: privat
Jens Hillmann. Foto: privat
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Mathematik zu studieren?
Nach dem Abitur, das ich extern in einer Nichtschülerprüfung abgelegt habe, kamen für mich Mathematik, Physik und Informatik als Studienfächer in die engere Wahl. Ich habe dann mehrere Unis und Fachbereiche besucht und mich für ein Mathematikstudium an der TU Berlin entschieden. Mein Schwerpunkt im Hauptstudium war Diskrete Optimierung.
Spielt das Fachgebiet für Ihre Arbeit eine Rolle?
Nein, im Moment nicht. Es sind eher die allgemeinen Kompetenzen, die ich im Studium erworben habe, die mich für die Arbeit als Performance Analyst qualifizieren. Dazu gehört, klar zu denken, Annahmen kritisch zu überprüfen, um auf diesem Wege Probleme zu lösen.
Wie sind Sie vom Mathematik-Studium zur Datenanalyse im Sport gekommen?
Bereits in der Schule habe ich als Leistungssportler Hockey gespielt und als Trainer gearbeitet. Als ich während des Studiums die Damenmannschaft des Berliner Hockeyclubs als Assistent gecoacht habe, fing ich an, Spielanalysen auf der Grundlage von Videoaufzeichnungen zu machen. So hat sich für mich ein Arbeitsfeld an der Schnittstelle von Sport und Technologie ergeben. Heute bin ich selbstständiger Hockey-Trainer und IT-Berater im Bereich Spielanalyse. In diese Nische bin ich mehr oder weniger hineingestolpert. Und ich bin dabei geblieben, weil ich neugierig bin und es spannend finde, zwischen verschiedenen Projekten hin und her zu pendeln und mit immer neuen Fragen konfrontiert zu werden.
Was bedeutet IT-gestützte Spielanalyse genau?
Die IT-gestützte Spiel- und Leistungsanalyse gibt zeitnah Antworten auf komplexe Fragen bezüglich des Spielgeschehens und der Leistung der Athleten. Früher wurden Statistiken mit Klemmbrett und Bleistift geführt und separat VHS-Videos aufgezeichnet. Durch die Informationstechnologie lassen sich beide Verfahren auf effiziente Art und Weise miteinander kombinieren. Große Datenmengen werden erfasst und komplexe statistische Zusammenhänge so visualisiert, dass sie für Trainer und Athleten handhabbar und möglichst leicht verständlich sind.
Womit beschäftigen Sie sich in Ihren Projekten?
Ein großer Teil der Spielanalyse ist die Vermittlung der Ergebnisse an die Spieler. Dafür spielt die Videoaufzeichnung eine wichtige Rolle, und insofern ist es dann entscheidend, wie schnell ich die Bilder nach dem Spiel an die Mitspieler weitergeben kann. Geht das vielleicht mithilfe verschiedener Technologien schon während des Spiels? Mit Lösungen für solche Fragen experimentiere ich als Digital Coach im Hockey. Als fertiges Produkt kann ich sie dann oft an meine Auftraggeber im Profisport weitergeben. Man könnte also sagen, der Hockey-Sport ist der Bereich, in dem ich Research und Development betreibe und der Profisport der, wo ich die Ergebnisse verkaufe.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Im Fußball ist es inzwischen so, dass der Analyst versucht, noch während des Spiels Rückmeldungen zu verschiedenen spieltaktischen Anforderungen an den Trainer weiterzugeben. Für Bayern München habe ich an der Einrichtung der Soft- und Hardware mitgewirkt, mit der es möglich ist, die aufbereiteten Videos und Daten auf dem Server parat zu haben, wenn die Trainer in der Halbzeit in die Kabine kommen. Dafür musste ich in erster Linie IT-technische Probleme lösen.
Wie viel Mathematik steckt in diesen Aufgabe?
Im Fußball werden viele Informationen als Daten erfasst, zum Beispiel die Position der Spieler auf dem Feld, 25- mal pro Sekunde. Inzwischen kommen auch medizinische Daten hinzu. Man misst den Herzschlag und schätzt ab, wann bei wem Ermüdung einsetzt, woraus man wiederum Rückschlüsse auf die Belastung der Spieler ziehen kann. Die inhaltliche Verknüpfung dieser verschiedenen Arten von Daten und die technische Umsetzung beinhaltet Ansätze von mathematischer Optimierung. Dafür gibt es kein fertiges Software-Produkt, das ist Handarbeit. Ein ganzes Mathematikstudium braucht man dafür ganz bestimmt nicht, da hätte ein Bachelor gereicht. Aber das kann sich jederzeit ändern.
Wo liegen derzeit die Grenzen für IT-gestützte Spielanalysen?
Im Moment sind der Anwendung komplexer mathematischer Modelle durch die zeitlichen Abläufe Grenzen gesetzt. Wenn am Samstag ein Spiel ist, am Montag darauf das nächste Training und die Spielvorbereitung für das nächste Wochenende am Dienstag oder Mittwoch beginnt, dann hat man nicht viel Zeit zu „rechnen“. Wenn man für ein großes Optimierungsprojekt in der Mathematik den Rechner anwirft und losrechnet, dann kann sich das länger hinziehen. Wir dagegen müssen schnell Antworten finden.
Welche Rolle nehmen Sie in der Welt des Profisports ein?
In habe oft den Part des Übersetzers. Denn häufig ist es so, dass den Technikern der Zugang zum Sport fehlt, und umgekehrt fehlt den Trainern die Vorstellung davon, was technisch möglich ist. Ich kann in beide Richtungen denken und kommunizieren. Ein Beispiel dafür, wie ich diese Nische ausfülle, ist ein Beratungsprojekt für die Deutsche Fußballliga, das unmittelbar bevorsteht. Die DFL ist die Organisation, die in Deutschland den Profifußball organisiert und vermarktet. Sie kauft die Daten bei einem Hersteller, gibt sie an die Bundesliga-Vereine weiter und ist mit ihnen im Austausch darüber, was in Zukunft bei der Herstellung und Auswertung der Daten verändert werden kann. Ich gehöre zu dem Team, das diese Kommunikations- und Veränderungsprozesse begleitet und zu Ideen Stellung nimmt – von der technischen und der sportlichen Seite her.
Wo sehen Sie das Potenzial für mathematische Anwendungen?
Anders als im Baseball oder im Football hat man im Fußball gerade erst angefangen, sich mit den technischen Möglichkeiten der Spielanalyse auseinanderzusetzen. Es gibt auch Leute, die sich dagegen wehren. Aber es ist ganz klar, dass diese Entwicklung unaufhaltsam ist. Potenziell sind diese Daten viel Geld wert. Wenn man zum Beispiel an die Evaluierung einzelner Fußballspieler denkt. Was ein Spieler wert ist, entscheiden Experten aufgrund der Leistung, des Alters, einer bestimmten Krankheitsgeschichte. Solche Entscheidungen könnten künftig auf einer breiteren Datenbasis getroffen werden. Und um aus diesen Daten wertvolle Informationen zu extrahieren, kämen definitiv mathematische Verfahren wie zum Beispiel Modellierung ins Spiel.
Sind andere Länder schon weiter?
Generell gibt es in den angelsächsischen Ländern, insbesondere in den USA mehr Offenheit im Sport dafür, sich Inspiration in anderen Bereichen zu suchen. Außerdem sind Sportarten wie Baseball oder Football statischer, das heißt, sie eignen sich besser für statistische Auswertungen. 2003 ist in den USA das Buch Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game erschienen. Es erzählt die wahre Geschichte eines wenig finanzkräftigen und wenig erfolgreichen Baseballclubs, dessen Manager mithilfe statistischer Analysen eine Mannschaft aus bislang unterbewerteten Spielern zusammenstellt und den Verein damit an die Spitze der Liga bringt. Das Buch hat den Profisport in den USA umgewälzt. Nach dem Motto: Wir müssen das jetzt alle machen, denn das ist profitabel.
Wie sieht die Branche im Vergleich zu Deutschland aus?
In Großbritannien, den USA und Australien ist das Berufsbild Performance Analyst schon weiter entwickelt. An der Universität Cardiff, in Wales, gibt es den ersten Masterstudiengang, der Sport und Informatik miteinander verbindet. Sportvereine und Verbände sind in diesen Ländern auch eher bereit, Geld für eine professionelle, technisch unterstützte Leistungsanalyse auszugeben. Die Diskussionen darüber, was eine solche Datenanalyse dem Sport bringt, wo sie nützlich ist und wo nicht, werden dort schon länger geführt. Deshalb ist der Einsatz der Datenanalyse schon routinierter. In Deutschland ist die Branche wesentlich kleiner, mit einer übersichtlichen Zahl an Akteuren. Es sind mit Sicherheit weniger als hundert. Aber da muss man genauer hinschauen, wer von den Spielanalysten in den Vereinen tatsächlich auch den technischen Hintergrund mitbringt.
Wie schaffen Mathematikerinnen und Mathematiker am besten einen Einstieg in diesen Beruf?
Man sollte auf jeden Fall eine Affinität zum Sport mitbringen, und man braucht sehr gute kommunikative Fähigkeiten. Als Trainer muss man nicht gearbeitet haben, aber man sollte mit den Entscheidern in den Clubs, den Trainern, den Managern, den Entscheidern in den Verbänden sprechen können über die Fragen, die den Sport betreffen. Nur ein guter Sportler oder ein guter Mathematiker oder Informatiker zu sein, das reicht für diesen Beruf nicht aus, es muss schon beides zusammenkommen.
Das Gespräch führte Kristina Vaillant,
freie Journalistin in Berlin.
www.vaillant-texte.de