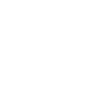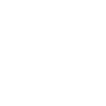Björn Mäurer kam von der Reinen Mathematik ans Institut für Angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig. Dort rief er die Software IDA ins Leben, mit der deutsche Spitzensportler gemeinsam mit ihren Trainern das Training dokumentieren und planen können. Inzwischen ist IDA so komplex, dass das Entwicklungsteam auf zehn Personen angewachsen ist. In seiner Freizeit macht Björn Mäurer intensiv Musik und schätzt die Flexibilität, die ihm seine Stelle als Softwareentwickler dafür gibt.
 Björn Mäurer. Foto: Privat
Björn Mäurer. Foto: Privat
Mathe und Sport, das klingt erstmal nach disjunkten Welten. Was ist die Schnittmenge?
Um heutzutage sportlich weit zu kommen, reicht es gerade im Spitzensport nicht, einfach aus dem Bauch heraus zu trainieren. Jeder Körper ist anders, und was gut für einen muskulären Aufbau und für eine Verbesserung von Techniken ist, kann man nicht einfach so vom Hingucken entscheiden, sondern es geht um ganz kleine Feinheiten. Die Weltspitze ist normalerweise dicht beieinander. Zwischen erstem und zweitem Platz liegen manchmal nur Hundertstelsekunden. Genau da kommen Messtechnik und damit Daten ins Spiel. Was man als Mathematiker im Sport macht, ist Datenverarbeitung. Aber auch bei den Auswertungen, also wie man aussagekräftige Statistiken macht, sind Leute gefragt, die davon Ahnung haben. Es geht um Trainingsdaten im erweiterten Sinne. Das schließt auch Wettkampfdaten ein, denn Wettkampf ist sozusagen Training unter Maximalkrafteinsetzung. Dann gibt es noch Leistungsdiagnostik, das ist ein Training unter Laborbedingungen, wo noch mehr gemessen wird. Die ganzen Daten müssen aufbereitet werden, damit der Trainer, in unserem Fall ist das meistens der Bundestrainer, eruieren kann, was das Training gebracht hat und wie weiter trainiert werden soll.
Du arbeitest am Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT). Was ist angewandte Trainingswissenschaft?
Trainingswissenschaft beschäftigt sich im Wesentlichen damit, wie ein Körper trainiert werden kann, also wie Muskelaufbau funktioniert und wie man Fertigkeiten trainiert. Die Grundlagenforschung, also die reine Trainingswissenschaft, wird an der Hochschule gemacht. Angewandte Trainingswissenschaft ist dagegen die wissenschaftliche Unterstützung für den deutschen Spitzensport. Es geht darum, dass die gewonnenen Erkenntnisse beim Sportler ankommen.
Gehört das IAT zur Uni?
Nein, das ist ein Bundesinstitut. Offiziell ist es am IAT/FES e. V. aufgehängt. Das FES, also das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, ist unser Partnerinstitut in Berlin. Die bauen Bobs, Kanus und Fahrräder, also das Sportgerät, und zwar konkret angepasst auf einzelne Sportler. Das Institut für Angewandte Trainingswissenschaft macht alles, was mit Trainingsdaten zu tun hat, bietet also die nichtmaterielle Hilfestellung. Finanziert werden wir im Wesentlichen vom Bundesinnenministerium. Wir sind für ganz Deutschland zuständig.
Du arbeitest im Bereich Softwareentwicklung. Was kann man mit eurer Software machen?
Wir entwickeln die Trainingsdaten-Dokumentationssoftware IDA. Die IDA unterstützt die Daten für den Zyklus aus Planung, Training und Analyse. Es gibt Makrozyklen, da geht es beispielsweise um den vier Jahre langen Olympiazyklus. Mesozyklen sind etwa Vorbereitungsphase, unmittelbare Wettkampfvorbereitung, Wettkampfphase. Und schließlich kann man das Ganze herunterbrechen auf Wochen, Tage oder Trainingseinheiten. Die Sportler loggen sich ein und kriegen über die Software ihren von den Trainern erstellten Trainingsplan bereitgestellt. Die Sportler trainieren danach und dokumentieren, was sie gemacht haben, also ob sie dem Trainingsplan genau ge- folgt sind oder an welchen Stellen sie abgewichen sind. Manches kann nur der Sportler protokollieren. So was wie mentale Fitness, wie entspannt stehe ich auf? Wie aktiviert fühle ich mich? Mentale und körperliche Leistungsfähigkeit werden in Skalen angegeben, damit der Trainer ein Gefühl dafür bekommt, wie es dem Sportler geht und was er ihm zumuten kann. Gerade bei den A-Kadern ist der Trainer nicht immer vor Ort. Zum Beispiel trainieren die Mitglieder der Nationalmannschaft Schwimmen jeweils in ihren Hallen. Trotzdem muss der Bundestrainer natürlich einen Eindruck von seinen Kadersportlern bekommen. Dabei hilft ihm die Software.
Welche deutschen Olympiateilnehmer benutzen eure Software?
Namen darf ich nicht nennen, da man als Entwickler alle Daten, die man sieht, vertraulich zu behandeln hat. Davon abgesehen habe ich auch nicht direkt mit den später eingepflegten Inhalten zu tun. Generell hängt das immer davon ab, wie die Sportart tickt und wie datengetrieben der Bundestrainer und der Trainerstab denken. Wenn der Trainer die Software aktiv nutzt, dann färbt das ab und die Sportler nutzen sie auch intensiv. Wir haben ungefähr 40 Sportarten. Die Software ist extrem konfigurierbar, sie beinhaltet für jede einzelne Sportart genau die Parameter und Kenngrößen, die ein Training ausmachen. Für eine Einzelsportart, sagen wir mal den Langstreckenlauf, sind ganz andere Kenngrößen für das Training wichtig als für einen Mannschaftssport wie Handball. Die trainieren anders, die protokollieren ihr Training anders. Im Snowboard haben wir drei verschiedene sogenannte Instanzen, da gibt es Cross, Freestyle und Race. Die sind inhaltlich schon so weit auseinander, dass man das nicht mehr gut mit einem Parametersystem abbilden kann. Die Software ist im Laufe der Zeit sehr komplex geworden. Am Anfang habe ich ganz allein daran gearbeitet, inzwischen sind wir ein ganzes Team. Im Spitzensport geht es eben um Nuancen. Eine Garmin-Uhr, also eine Smartwatch, die das Training von allein misst, bringt im Spitzensport in den meisten Fällen nicht wahnsinnig viel. Diese Uhren mitteln viel heraus und die Spitzensportler sind in aller Regel so weit von der Norm weg, dass eine normale Breitensportuhr das als Messfehler abtun würde. Diese feinen Nuancen, die der Spitzensport braucht, deckt man nur ab, indem man sehr detailliert rangeht. Viel Geld verdienen kann man damit allerdings nicht, weil es zu wenige Leute sind. Es sind schon sehr spezielle Daten.
Was ist heute Deine Rolle bei der Softwareentwicklung?
Ich bin inzwischen im Backend-Team. Ich beschäftige mich also nicht damit, was im Browser oder auf dem Handy, sondern was bei uns auf der Serverseite passiert, also wie die Daten in die Datenbank reinkommen, wie die Auswertungen gebaut werden, die zur Verfügung gestellt werden und so weiter. Ich würde sagen, es ist nichts Ungewöhnliches für einen Mathematiker, dass man an so einer Stelle landet. Ich bin auch nicht der Einzige.
Was sind die fachlichen Hintergründe Deiner Kollegen?
Das IDA-Team setzt sich aus Informatikern, Mathematikern und Physikern zusammen. Wir sind dort zehn Leute, in der Sportinformatik insgesamt vierzehn. Das Institut hat ungefähr 140 Mitarbeiter. Das sind im Wesentlichen Sportwissenschaftler. In der Softwareentwicklung nehmen wir lieber Senior-Entwickler, das ist für uns einfacher. Man sollte also möglichst schon Berufserfahrung mitbringen.
Wie sieht Dein Arbeitsalltag aus? Arbeitest Du die meiste Zeit allein oder hast Du viele Meetings?
Wir arbeiten nach Scrum. Das ist eine agile Softwareentwicklungsphilosophie, wo man Sprints plant. Alle zwei Wochen planen wir, was wir in den nächsten zwei Wochen machen wollen. Wir haben täglich unser sogenanntes Daily, wo man sagt, was man an dem Tag vorhat und abspricht, wen man dafür braucht. Und dann gibt es die typischen Scrum-Meetings zum Sprintwechsel, also Planning und Retro. Man hat schon relativ viel miteinander zu tun. Wenn man ein Stück der Software fertig hat, dann wird die von einem Kollegen reviewt. Der guckt, wie man das programmiert hat und ob alles so funktioniert, wie man sich das ausgedacht hat. Wenn der noch etwas sieht, dann wird während des sogenannten Pull-Requests darüber geredet. Das ist die Anfrage, dass der überarbeitete Teil in den Hauptstrang der Software mit reinkommt. Außerdem gibt es noch die sogenannten technischen Diskussionen. Da ist man zu dritt oder viert und überlegt sich, wie man einen bestimmten Softwareteil genau aufbauen will. Erwähnenswert ist vielleicht auch, dass wir
von zu Hause aus oder am Institut arbeiten können. Beim Sprintwechsel wollen wir gerne alle am Institut sein. Ansonsten ist das relativ frei. Als Mathematiker hat man auch in anderen Unternehmen in aller Regel eher wenig Kundenkontakt. Damit hat man eine gewisse Freiheit, was die Zeit betrifft, weil man selten unverrückbare Termine hat. Am IAT haben wir Gleitzeit und können den Urlaub relativ frei wählen. Wir müssen nicht am Anfang des Jahres schon sagen, wann wir Urlaub machen. Ich spiele in meiner Freizeit sehr intensiv Geige und da gibt es oft Proben und Konzerte. Arbeitsmäßig eine gewisse Freiheit zu haben, ist da sehr angenehm. Ich glaube, die meisten Jobs für Mathematiker bringen diese Möglichkeiten mit sich.
Mit welchen Fragestellungen hast Du Dich in den letzten Tagen beschäftigt?
Es ging viel um APIs, also darum, wie verschiedene Maschinen miteinander reden. Wir haben einerseits die Daten, die von den Sportlern bei uns eingegeben werden. Es gibt aber natürlich ganz viele andere Datenquellen, von denen Daten zu den Sportlern oder zu Konkurrenzsportlern herkommen können, beispielsweise aus Wettkampf-Datenbanken. Die Frage ist dann, wie kriege ich diese Daten von einer anderen Datenbank in unsere Datenbank hinein? Wir wollen möglichst viele Daten haben, um den Bundestrainern eine umfassende Analyse zur Verfügung stellen zu können.
Spielt Künstliche Intelligenz bei euch eine Rolle?
KI spielt bei der Datenerhebung in der Messtechnik eine Rolle. Aber auf den Daten, die wir haben, machen wir im Augenblick nichts mit KI. Wir probieren viel damit herum, aber es fehlt an vielen Stellen die Datenmenge, um mit KI gut ranzukommen. KI wird dann interessant, wenn man viele Daten hat, und das ist bei uns nicht der Fall, weil es nicht so viele Spitzensportler gibt. Das sind ja einzelne Individuen, die aus irgendwelchen Gründen besonders gut sind. Man kann nicht aus jedem Menschen einen Olympiasieger machen. Wir unterstützen mit unserer Software die Auslese. Auch so etwas wie Trainingsempfehlungen machen nicht wir. Wir bekommen Daten von den Sportlern und ihren Trainern und bereiten diese analytisch auf. Die Empfehlungen kommen immer vom Trainer selbst, nicht von der Software. Wir machen nur die Datenaufbereitung, damit der Trainer gut über den Zustand des Sportlers informiert ist. Natürlich ist eine tiefergehende Analyse der Daten, dann in anonymisierter Form, denkbar. Das müsste dann aber in einem gesonderten wissenschaftlichen Projekt verankert werden.
Lasst ihr euch beim Programmieren von generativen Sprachmodellen unterstützen?
Man kann sich da helfen lassen, aber es wird tatsächlich erstaunlich wenig gemacht. Man kann KI-Unterstützung in die Programmierumgebung integrieren. Oft ist es aber so, dass KI uns durch die Komplexität der Software nicht so viel helfen kann.
Wie sieht die Datenaufbereitung, von der Du gerade gesprochen hast, konkreter aus?
Da geht es um Fragen wie: Welche Parameter brauchen wir, um das Training gut zu beschreiben? Wie stellt man Daten so dar, dass der Trainer auf einen Blick den Ist-Zustand erkennen kann? Mit anderen Worten, welche Diagramme sind gut? Welche Daten muss ich erheben, um eine Aussage über ein Verletzungsrisiko treffen zu können? Wenn ich zum Beispiel eine Weile wenig trainiert habe, dann ist für den Körper nicht gut, sofort wieder von null auf hundert zu gehen. Dazu gibt es bestimmte Formeln wie das „Acute:Chronic Workload Ratio“. Anhand von diesem sieht der Trainer sofort, wir haben in der letzten Woche das und das gemacht und können jetzt nicht übertrieben viel trainieren, sondern müssen langsam hochgehen. Wie funktioniert es, wenn der Sportler krank geworden ist, er abtrainiert und weniger machen muss? Was kann er tun, wenn er eine Verletzung hat, damit er trotzdem im Training bleibt und nach seiner Genesung schnell wieder durchstarten kann? Aber das ist eigentlich nicht das, womit ich mich beschäftige. Die Auswertung machen bei uns die Sportwissenschaftler. Ich als Mathematiker sorge lediglich für den technischen Hintergrund, also dass alle möglichen Diagramme und Tabellen aus der Datenbank so rausgehen, dass Reports generiert werden können. Das sind PDF-Dateien für die Sportler. Darin sind beispielsweise für die Skispringer ihre Sprünge gut dokumentiert, damit sie wissen, wie sind sie gesprungen, wie war die Haltung, wie waren die Kräfte auf dem Schanzentisch und so weiter.
Hast Du inhaltlich noch mit Mathematik zu tun?
Nein, eigentlich nicht. Aber wenn es datenmäßig und mathematisch wird, dann stehen wir als Mathematiker natürlich zur Verfügung. Manchmal gibt es statistische Fragen. Also wie für eine Analyse die Statistik so aufgebaut werden kann, dass sie aussagekräftig ist. So etwas habe ich im Studium gar nicht gemacht. Für solche Fragen bin ich ganz dankbar, da kann man seinen Geist mal wieder benutzen.
Würdest Du sagen, das Mathestudium war eine gute Vorbereitung für Deinen Job?
Am Anfang hat mir an manchen Stellen ein bisschen die Informatik-Seite gefehlt. Aber Mathe war insofern eine sehr gute Vorbereitung, als dass man sich als Mathematiker in bestimmte Themen sehr schnell einarbeiten kann. Man erkennt Strukturen wahnsinnig schnell. Es kommt dann eben noch eine Programmiersprache dazu. Da kommt man aber schnell rein. Das ist am Ende eine ganz normale Grammatik.
Hast Du das Programmieren erst on the job gelernt?
Ja, eigentlich schon. Ich hatte im Studium zwar Informatik als Nebenfach, aber habe dort nicht so viel in Richtung Anwendungen gemacht. Mich hat im Studium mehr die theoretische Seite interessiert. In der Mathematik habe ich mich mit Algebra, Kategorientheorie und so etwas beschäftigt. Und auch in der Informatik habe ich im Wesentlichen theoretische Themen gewählt. Deswegen war ich rein praktisch nicht vorbereitet. Das war aber, ehrlich gesagt, nicht schlimm. Man darf natürlich keine Angst haben, sondern man muss einfach sagen, ich mache das jetzt und dann fuchst man sich da rein. Meiner Meinung nach ist es ohnehin so, dass es, wenn man als Mathematiker die Uni verlässt, rein intellektuell leichter wird.
Wie war Dein Weg von der Algebra zur Softwareentwicklung?
Ich habe in Leipzig Mathematik studiert und dort danach bei einem Graduiertenkolleg ein Promotionsstudium angefangen. Das lief auch eine ganze Weile. Danach war ich aber noch nicht fertig und habe als Mitarbeiter an der Uni weitergemacht. Irgendwann war nicht mehr klar, wie das mit der Finanzierung funktioniert. Mir ist ein Tipp gegeben worden, dass am IAT eine Stelle ausgeschrieben ist, die eigentlich ganz interessant klingt. Damals ging es auch noch ein bisschen um die Technologie, um Messtechnik, was ich inzwischen nicht mehr mache. Das hat mich interessiert. Außerdem gab es die Möglichkeit, die Promotion innerhalb des Jobs noch zu Ende zu bringen. Was ich dann nicht gemacht habe, aber das ist eine andere Geschichte. Für mich war die Stelle vor allem erstmal eine Möglichkeit, ein bisschen Sicherheit ins Leben zu kriegen, zumal ich genau in der Zeit Vater geworden bin. Da waren meine Prämissen dann ein bisschen anders. Der tiefer liegende Grund, warum ich die Stelle genommen habe, war also nicht, dass ich unbedingt im Sport arbeiten wollte. Sondern ich wollte in Leipzig bleiben und insgesamt wirkte es für mich recht interessant. Das war es auch und ist es immer noch.
Du hast gesagt, dass Du dort zunächst der Einzige in Deinem Bereich warst.
Ich habe den Auftrag bekommen, eine Trainingsdaten-Software für drei Sportarten zu entwickeln, und habe daran erstmal allein gearbeitet. Ich habe mir gesagt, statt dreimal programmiere ich das lieber einmal und mache es direkt konfigurierbar. Weil ich das so gelöst habe, sind dann mehr Sportarten dazugekommen und es war klar, dass noch mehr Anfragen kommen. Deswegen sind nach und nach mehr Leute eingestellt worden. Es sind Informatiker dazugekommen, die ein bisschen andere Skills mitbringen. Sie wissen einfach besser, wie man bestimmte Dinge sinnvoll macht, und kennen die Standardlösungen. Wenn man von außen kommt, erfindet man schon manchmal das Rad neu. Irgendwann ist die Software so komplex geworden, dass wir uns aufgeteilt haben. In der Informatik nennt sich das Fullstack, wenn man alles macht. Wir sind von der Fullstack-Entwicklung weggegangen und haben uns ausdifferenziert in Frontend und Backend und sowas. Und da bin ich im Backend gelandet.
Ist es für Dich noch ein Thema, dass Du Deine Doktorarbeit nicht abgeschlossen hast?
Nein. Aber ich muss zugeben, das war keine leichte Entscheidung, denn ich war schon relativ weit. Die verschiedenen Prämissen im Leben zu ordnen und zu priorisieren und dann zu merken, dass man das eigentlich nicht mehr will oder nicht mehr schafft und auch nicht mehr schaffen will, war keine einfache Sache. Ich hatte wie gesagt ein Kind, für das ich Zeit haben wollte. Da muss man sich überlegen, wie viel man nebenbei noch machen will. Ich mache in meiner Freizeit sehr intensiv Musik. Auch dafür wollte ich Zeit haben. Die Promotion passte da irgendwann nicht mehr rein, und einen Vorteil hätte der Doktortitel für mich auch nicht gehabt. Ich hatte von meinem Arbeitgeber aus einen Tag die Woche für meine Promotion zur Verfügung. Und seien wir ehrlich, gerade in der Mathematik, wo man so verzwirbelt denkt, muss man am Ball bleiben können. Ich habe oft den halben Tag dafür gebraucht, um mich wieder reinzudenken, was ich in der Woche vorher gemacht hatte. Das ist dann schon ein bisschen frustrierend. Aufzuhören war eine gute Entscheidung und sehr befreiend. Es war trotzdem eine schöne Zeit. Mich in mein Thema richtig tief eingewühlt zu haben, möchte ich nicht missen. Auch menschlich hat mich das weitergebracht. Es ist eine ganze Menge, was man da mitnehmen kann. Man muss es nur wahrnehmen, weil man es halt nicht schriftlich hat. Ob ich den Weg bis zum Ende gegangen bin oder nicht, ist für mich inzwischen relativ irrelevant. Es fühlt sich zwar erstmal wie eine Niederlage an. Irgendwann sagt man aber, nein, es war ein Lebensabschnitt.
Wenn man im Mathestudium steckt und sich für den Bereich Softwareentwicklung interessiert: Was sollte man mitbringen? Wie sollte man sich vielleicht vorbereiten?
Vorbereiten braucht man sich eigentlich nicht. Die meisten haben sich schon mal ein bisschen mit Daten ausein andergesetzt, beispielsweise mal eine MySQL-Datenbank aufgesetzt. Es hilft schon, wenn man ein paar Datenstrukturen kennt und weiß, wie Datenabfragen funktionieren. Bei mir war es so, dass ich in meiner Freizeit Webseiten gemacht habe, die interaktive Bereiche hatten. Dort konnten sich die Mitglieder von einem Orchester zurückmelden, ob sie bei einem bestimmten Projekt mitmachen. Dadurch bin ich immerhin so weit reingekommen, dass die Einarbeitung in die richtige Software relativ einfach war. Bei den Leuten, die sich für sowas interessieren, passiert das in den meisten Fällen sowieso von ganz allein. Wenn jemand nur Mathematiker ist und mit Rechnern gar nichts anfangen kann, dann ist es, glaube ich, das Falsche. Aber wenn man diese Logik, die in solchen Maschinen steckt, spannend findet, dann kommt man da relativ gut rein.
Welche Programmiersprachen benutzt ihr?
Wir haben ein ganzes Sammelsurium. Ursprünglich haben wir mit PHP angefangen. Der Backend Core ist inzwischen ein getyptes PHP. Wir sind nicht ganz glücklich damit, aber ist halt so gewachsen. Im Frontend haben wir TypeScript mit einem Vue-Aufsatz. Im Backend haben wir auch TypeScript und noch ein bisschen Go. Für Microservices, die bestimmte Sachen zur Verfügung stellen und Reports generieren, sind es unter Umständen noch andere Programmiersprachen. Und das ganze CICD, also das Bereitstellen der Software, läuft über Bash-Scripts. Ich habe bestimmt einiges vergessen, es ist recht vielfältig.
Hast Du noch Ratschläge oder Gedanken, die Du loswerden möchtest?
Aus meiner Sicht ist zu empfehlen, mal ganz woanders zu sein, auch wenn es rein inhaltlich nicht nötig ist. Ich habe im Studium ein Auslandsjahr in Norwegen gemacht. Diese Zeit hat mich menschlich sehr weitergebracht. Ich komme aus Jena, das ist nicht wahnsinnig weit weg, aber immerhin nicht Leipzig. Dann mal ein Jahr an einem ganz anderen Ort im Ausland zu sein, war für mich persönlich durchaus wichtig. Es hat mich auch für meinen Job weitergebracht. In Oslo gibt es ein ähnliches Institut wie unseres. Dort war ich mal auf einer Konferenz, die auf Norwegisch stattfand und konnte mich in der Landessprache mit den Leuten unterhalten, was die so für Probleme haben. Das waren ähnliche wie bei uns am Institut.
Würdest Du sagen, Du fühlst Dich heute noch als Mathematiker?
Oh, das ist eine gute Frage. Rein beruflich und inhaltlich bin ich kein Mathematiker mehr. In den Themen aus dem Grundstudium und der Algebra bin ich schon noch halbwegs fit, denke ich. Aber wenn ich mir meine Mathematik-Fachliteratur hernehme, merke ich deutlich, dass ich viel vergessen habe. Es ist schwierig, da komplett wieder reinzukommen, vor allem in das, was ich zum Schluss gemacht habe. Aber man hat logisches, strukturelles Denken am Beispiel der Mathematik gelernt. Von der Mathematik ist wirklich übrig geblieben, dass ich mich in Fragestellungen, die mich intellektuell, also von der Logik her interessieren, immer noch ziemlich gut verbeißen kann. Dieser Wissensdrang, den man in der Mathematik auf der logischen Ebene hat, der ist noch da.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führte Kari Küster.