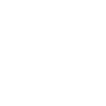Das Mathematikstudium hat Tradition in seiner Familie. Nach Großeltern und Mutter ist Benjamin Staude Mathematiker in dritter Generation. Der gebürtige Bremer hat als leidenschaftlicher Problemlöser und Methodenentwickler schon viele Unternehmungen vorangebracht: in den Neurowissenschaften, der Immobilienbranche und der Kunst. Man fragt sich, was als nächstes kommt. Benjamin Staude lebt als freiberuflicher Berater in Berlin-Kreuzberg, wo wir uns auch zum Gespräch treffen.
 Benjamin Staude. Foto: Christoph Eyrich
Benjamin Staude. Foto: Christoph Eyrich
Herr Staude, Sie sind vom Studium der Mathematik über die Promotion in der Hirnforschung zum Start-up- Gründer geworden. Außerdem beraten Sie Künstler. Ist der gemeinsame Nenner die Mathematik?
Ich würde nicht sagen, dass es die inhaltliche Mathematik ist, also die konkreten Methoden, die ich im Studium gelernt habe. Aber die Art des Denkens wahrscheinlich schon. Mich haben die Inhalte der Probleme, an denen ich gearbeitet habe, nie so wahnsinnig interessiert, dass ich mich von alleine darauf gestürzt hätte. Ich habe mich immer mehr mit der Problemlösung beschäftigt. Bei der Promotion war ich bei einer Physikerin, die – vielleicht würde man sagen – sehr hemdsärmlich gearbeitet hat, also nicht mit wahnsinnig theoretischem Überbau. Sie hat die Daten angeguckt, hat Inspiration daraus gezogen und dann versucht, irgendwie Methoden zu entwickeln, mit denen sie ihre Intuition auch quantifizieren kann. Und da habe ich ihr bei geholfen. Natürlich habe ich mich für die Biologie interessiert und wollte auch verstehen, wie das Hirn funktioniert. Aber mein Hauptantrieb war eigentlich: Sie hat ein Problem, ich glaube, ich kann ihr helfen. Super, let’s do it. Und so ging es dann mit den Künstlern auch weiter. Da geht es weniger darum, dass die ein konkretes Problem haben, was gelöst werden soll, sondern man arbeitet gemeinsam an Ideen des Künstlers: was kann man wie umsetzen, welche Alternativen kann man anbieten? Das ist mehr ein Kreislaufprozess, als wenn man mathematischer Dienstleister in einer biologischen Arbeitsgruppe ist. Und beim Start-up war das auch so. Da wusste mein Mitgründer, wo das Problem in der Immobilienindustrie liegt, hatte aber nicht die technischen Fähigkeiten, um zu übersetzen, was dann konkret programmiert werden kann. Das habe ich gemacht haben. Mich haben die inhaltlichen Probleme der Immobilienindustrie jetzt nicht so wahnsinnig fasziniert – vorsichtig formuliert. Aber wenn man mit relativ bescheidenen theoretischen Mitteln die Probleme der Nutzer echt gut lösen kann, dann ist das einfach eine dankbare Rolle. Und das ist in allen Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, die Klammer gewesen.
Blicken wir auf die einzelnen Stationen. Könnten Sie noch einmal genauer erklären, was Sie als Mathematiker in der Neurowissenschaft gemacht haben?
Jetzt muss ich kurz nachdenken, das ist ja schon eine ganze Weile her. Seit den achtziger Jahren hatte es einen Wissenschaftsstreit gegeben. Ein Teil der theoretischen Neurowissenschaftler folgte der klassischen Theorie der Informationsverarbeitung: eine Nervenzelle feuert Aktionspotenziale und die durchschnittliche Feuerrate von so einem Neuron codiert die Information. Und dann gibt es Gruppen von Neuronen, die ihre Rate gemeinsam erhöhen, und so wird dann auch Information codiert. In diesem Model ist der genaue Zeitpunkt eines Aktionspotenzials vernachlässigbar, es geht eher um deren ungefähre Anzahl in einem bestimmten Zeitfenster. Die alternative Sicht der Dinge war, dass die Nervenzellen für bestimmte Informationen ihre einzelnen Aktionspotenziale synchronisieren müssen. Man hat damit sozusagen eine zusätzliche zeitliche Dimension. Und diese Theorie ist ziemlich schwierig experimentell nachzuweisen, weil man dafür die Aktivitäten von sehr vielen einzelnen Neuronen messen muss und dann nachweisen muss, dass diese Neurone öfter gleichzeitig feuern, als es statistisch vorhersagbar wäre. Das war das Problem. Und das Problem wird komplizierter, je mehr Neuronen ich betrachte. Wenn ich nur 15 Neuronen nehme und davon sind drei korreliert und noch einmal drei, dann entsteht dadurch öfter das Ereignis, dass alle sechs gemeinsam feuern. Aber nicht, weil alle sechs eigentlich zusammenhängen, sondern weil die Abhängigkeiten von den Untergruppen auch die Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Feuern dieser sechs Neuronen erhöhen. Das nennt man Higher- Order-Korrelation, also nicht nur paarweise Korrelation, sondern Korrelation von größeren Untergruppen. Und das macht die Unabhängigkeitsüberprüfung kombinatorisch einfach wahnsinnig kompliziert.
Und Sie haben die passenden mathematischen Modelle entwickelt.
Genau. Wir hatten die Idee, dass wenn man Korrelationen höherer Ordnung aufgrund der kombinatorischen Explosion nicht direkt messen kann, dass man vielleicht deren Spuren in einer Populationsstatistik nachweisen kann. Dafür haben wir dann eine relativ sensible Methode entwickelt. Wir haben die Statistik von solchen Populationsdynamiken entwickelt und Simulationsanalysen gemacht, um zu testen, wie gut sich das in der Realität nutzen lässt.
Wie sind Sie zu Beginn der 2000er Jahre zur neurowissenschaftlichen Forschung gekommen? Damals gab es ja einen regelrechten Hype darum.
Das war tatsächlich Zufall. Ich hatte mich im Studium ziemlich ferngehalten von der angewandten Mathematik – je abstrakter, desto besser. Ich habe 2003 meine Diplomarbeit in der Differentialgeometrie an der TU Berlin geschrieben und dann wollte ich eigentlich auch in so einem Bereich promovieren. Ich bin in Deutschland rumgefahren, war an den Unis in Münster und in Leipzig, habe mir das alles angeguckt und dann musste ich feststellen, dass mir eine Promotion in Mathematik gar nicht liegt.
In der reinen Mathematik . . .
Ja, genau, das war mir, glaube ich, zu einsam. Ich hatte das Gefühl, wenn du zu irgendeiner kleinen Konferenz mit fünf bis 20 Leuten kommst und eigentlich versteht keiner, was der Sitznachbar macht, dass das nicht meine Art zu arbeiten ist. Und dann bin ich ein bisschen in die Sinnkrise geraten, weil ich mich natürlich in meiner jugendlichen Naivität schon irgendwie als großen Mathematiker sah [lacht]. Also habe ich Mathe-Nachhilfe gegeben, weiter an der Uni als Tutor gearbeitet, und ich habe in Kneipen gearbeitet – was man in Berlin eben damals so gemacht hat. Musik habe ich auch gemacht. Und nach etwa einem Jahr dachte ich, irgendwie müsste wieder was passieren und habe über einen Freund einen anderen Freund getroffen, der Physiker war, und der hat mir von dieser Neurobiologin an der FU [Freie Universität] erzählt, die so interessante Sachen macht. Da gebe es so eine neue Theorie, die nennt man die Informationsgeometrie. Und dann dachte ich, Geometrie kann ich eigentlich ziemlich gut. Und dann bin ich zu der Professorin Sonja Grün gegangen, und wir mochten uns. Wir haben einen Antrag geschrieben für ein Promotionsstipendium und haben es gekriegt. Die Umgewöhnung von der schönen Welt der reinen Mathematik, wo ich mich wirklich sehr wohlgefühlt und die ich irgendwie geliebt habe, in die Realität der Mathematik, die man anwenden kann, war völlig unbefriedigend. Das hat mir ganz schön zugesetzt. Aber je mehr ich dann von der Biologie verstanden habe und mich auch philosophisch ein bisschen mit Fragen der Willensfreiheit und des Bewusstseins und so weiter beschäftigt habe, habe ich gemerkt, okay, ich kann auch in diesem neurowissenschaftlichen Bereich weitermachen. Und dann gefiel mir auch meine Rolle als Mathematiker in der Arbeitsgruppe ganz gut: Wenn irgendwer ein Problem hatte, dann habe ich da mitgemacht und die mathematiklastigen Paper, die habe ich reviewt und so weiter. Das war eine schöne Rolle und die hat dann meine Unzufriedenheit mit der Beschränktheit der mathematischen Methoden ganz gut aufgefangen.
Sie wurden dann 2008 nicht an der FU in Berlin, sondern in Freiburg promoviert.War das eine mathematische oder eine neurowissenschaftliche Dissertation?
Es war genau in der Mitte. Ich habe in Freiburg an der biologischen Fakultät promoviert. In Berlin hätte ich am Fachbereich Mathematik promovieren können. Aber das war ein bisschen eine Schwierigkeit, ich hatte Respekt vor einer Promotion in der Mathematik, weil ich ja eigentlich kaum ein mathematisches Umfeld hatte. Das heißt, ich wusste gar nicht, welche Fragen Mathematiker an meine Arbeit stellen würden und ich hatte ja auch nie Wahrscheinlichkeitstheorie studiert an der Uni.
Rund zwei Jahre nach der Promotion sind Sie ausgestiegen aus der Forschung. Warum?
Ich glaube, ein Grund war, dass meine Freundin, die jetzige Mutter meiner Kinder, die ganze Zeit in Berlin wohnte. Ich war zwei Jahre für die Forschung in Japan, danach in Freiburg und karriereplanungsmäßig wäre eigentlich klar gewesen, dass ich jetzt noch mal in die USA oder so gehe. Das war mein Gefühl, aber ich hatte gar keine Inspiration, wo ich hin soll. Und ich habe auch gemerkt, dass ich als Postdoc nicht mehr die Rolle als Gruppenmathematiker hatte, die mir viel Spaß gemacht hat, und die Arbeitsweise war viel theoretischer. Ich habe gemerkt, dass neben den Experimenten der wichtigste Teil der wissenschaftlichen Arbeit ist, meine eigene Fragestellung zu „verkaufen“. Also: Das ist das wichtigste Problem der ganzen Welt, und jetzt zeige ich Euch, wie man das löst. Und dieser Teil hat mich eigentlich nie wirklich interessiert. Also dachte ich: Soll ich für die Korrelationen höherer Ordnung wirklich mein Leben geben, so wie es andere Forscher in meinem Umfeld getan haben, die gebrannt haben dafür? So ging es mir irgendwie nicht. Ich will ja eigentlich nur die Methoden entwickeln, damit die Leute ihre Probleme lösen können. Aber so funktioniert Wissenschaft ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Du bekommst ja keine Professur dafür, dass du den Biologen hilfst, sondern für Deine eigenen Publikationen, und das war nicht die Rolle, die mir gefallen hat.
Und dann haben Sie 2013 das Start-up gegründet.
Da lagen noch mal zwei Jahre Pause dazwischen. Als erstes bin ich nach Berlin zurückgezogen. Schon in Freiburg hatte die Zusammenarbeit mit zwei Künstlern angefangen. Bei den Projekten ging es im weitesten Sinne um die Sonifizierung von neuronaler Aktivität.
Was meinen Sie mit Sonifizierung?
Also man hat diese Hirnaktivität, die Aktionspotenziale der Neuronen, und dann weist man jedem Neuron einen Ton zu und dann kann man sich das anhören. Damit haben die dann Kunst gemacht, in sehr unterschiedliche Richtungen.
Und mit diesen beiden Künstlern arbeiten sie nach wie vor zusammen.
Genau. Damals haben wir angefangen, und dann habe ich gemerkt das hört sich doch irgendwie interessant an und das macht Spaß, vielleicht kann man da ein Leben draus machen. Ich bin in Berlin zum Arbeitsamt gegangen, habe gesagt, das könnte die Idee sein, ich weiß aber nicht, ob das klappt. Und dann gab‘s diese Existenzgründungsförderung, die habe ich für anderthalb Jahre gekriegt.
Und wie kam es dann zur Gründung des Start-ups namens Architrave?
Durch einen ganz alten Freund von mir, Maurice Grassau, den ich noch aus Bremen kenne. Wir haben uns immer ein bisschen im Auge behalten. Und er hat Karriere gemacht als Verkäufer von Software und zog irgendwann auch nach Berlin und hat mich gefragt: Wollen wir nicht eine Firma gründen? Ich habe erst gesagt, nein, warum sollte ich. Dann wurde mir aber klar, dass dieses Beraten und Umsetzen bei künstlerisch-technischen Problemen im Alltag ganz schön nervig sein kann, wenn man sein Leben davon bestreiten will. Und dann dachte ich, ja, wieso nicht. Maurice ist ein sehr guter Verkäufer, das ist der Teil, den ich nicht will. Und dann schaufelt er mir sozusagen die Probleme vor der Tür, die ich lösen muss. Ich weiß, er ist ziemlich gut in dem, was er macht, und ich war bisher auch immer ganz gut, dann muss es doch eigentlich irgendwie klappen, lass uns das doch mal ausprobieren. Mein Gründungspartner hatte damals schon eine Dokumentenmanagement-Software verkauft, die in unterschiedlichen Branchen benutzt wurde. Er hatte große Immobilienkunden, die mit dieser Software aber alle ein bisschen unzufrieden waren. Und dann wurde ihm lustigerweise eine Software zum Kauf angeboten, die genau das konnte, was gewünscht war, aber ein bisschen veraltet war. Wir sind dann rumgefahren und haben ein paar Meetings gemacht mit Leuten aus seinem Netzwerk und haben uns dann mit einem Interaktionsdesigner getroffen, der erste Entwürfe gemacht hat. Die waren alle Feuer und Flamme.
Und ihre Rolle war es, die technische Seite dieser Software zu entwickeln.
Genau, ich war Chief Technology Officer, Geschäftsführer Technik heißt das vielleicht auf Deutsch. Ich habe angefangen zu programmieren und die alte Software analysiert. Programmiert hatte ich schon immer viel, aber Webentwicklung ist noch mal was anderes, das musste ich erst mal lernen. Nach einem Jahr hatten wir eine relativ gute Übersicht, was die Funktionalitätstiefe einer möglichen neuen Version war. Und dann haben wir uns nach Freelancern umgeschaut und haben glücklicherweise echt ganz gute gefunden, mit denen wir das zusammen gemacht haben.
Und Sie haben Investoren gesucht.
Genau, die braucht man natürlich auch.
Ein ganz klassisches Start-up also, wo erst mal ordentlich Geld reingepumpt wird und was erst mal keine Umsätze macht.
Nein, das war nicht ganz so klassisch, weil wir die erste Software ja gekauft hatten, und da gab es schon einen Kunden, das heißt, wir hatten monatlich Umsätze und dadurch natürlich auch gute Einsicht in die Anforderungen. Ich habe alle zwei Tage mit jemandem telefoniert, der diese Software genutzt hat. Ich glaube, so etwa anderthalb Jahre nach Gründung war die erste Version draußen. Dann waren wir irgendwann bei der schwarzen Null, aber wir waren immer noch zu zweit. Da hat man gemerkt, das funktioniert so nicht. Ich kann die Software nicht weiterentwickeln und gleichzeitig ans Telefon gehen, weil irgendwer ein Dokument nicht findet. Dann haben wir noch einmal Geld eingesammelt, es ging wieder so anderthalb Jahre und dann kam der nächste Investor. Wir haben immer Investments geholt, dann die Kosten hochgetrieben und ungefähr dann, wenn wir wieder bei der schwarzen Null waren, kam die nächste Runde.
Nach sechs Jahren, 2019, haben Sie das Start-up verlassen, wie groß war die Firma zu dem Zeitpunkt?
Hundert Leute ungefähr.
War es kein Problem für Sie, zwischen dieser Start-up-Welt und der Immobilienbranche auf der einen und der Welt der Kunst auf der anderen Seite hin- und her zu navigieren? Wie vertragen sich diese Welten miteinander?
Es gab natürlich immer eine gewisse Fremdheit in der Immobilienwelt. Aber die gab es in der Wissenschaft auch. Da habe ich auch nie viele Gleichgesinnte gefunden. Da gibt es eben Leute, mit denen man total gerne bestimmte Sachen diskutiert und das macht wahnsinnigen Spaß. Und die Art mit Wissenschaftlern zu diskutieren, ist einfach vollkommen anders als die, mit Künstlern zu diskutieren
. . .oder Investoren zu überzeugen . . .
Ja, aber das war nicht mein Job, zum Glück. Aber ich war natürlich immer mit dabei.
Da man muss sich ein Stück weit anpassen, oder?
Ja, natürlich bin ich auch mit dem Anzug morgens im Zug nach Frankfurt gefahren und so. Aber ich habe das immer ein bisschen mit Humor genommen, da hat man sich eben ein bisschen verkleidet. Das ist vielleicht manchmal ein Spagat, aber als technischer Leiter einer Softwarefirma muss man auch nicht das Businessdeutsch beherrschen. Man muss sich nicht in einer Frankfurter Bar den Immobilieninvestoren beweisen. Es war schön, dass mein Mitgründer das so gut konnte, damit die das Gefühl haben, da versteht sie einer. Aber die wollen ja auch, dass der Techniker seinen Kram macht, und wenn der über Sachen redet, die die nicht verstehen, umso besser. Dann ist das vielleicht sogar ein bisschen beeindruckend. Diese Rolle hatte ich, und die habe ich auch gerne angenommen. Unsere Kunden waren ja größtenteils institutionelle Investoren wie die Union Investment und nicht so die klassischen Immobilienhaie, die ein Haus billig kaufen und die Mieter rausdrängen. Ich fand es schon interessant im 32. Stock irgendwo in Frankfurt zu sitzen mit den Vorständen. Ich saß da und dachte: Wie kann denn das sein? Und genauso ist es interessant, irgendwo mit einem Künstler zu sein und in New York am National History Museum irgendeine Ausstellung aufzubauen, da denkt man auch nicht, dass man da mal hinkommt.
Heute arbeiten Sie als Berater für Start-ups und für künstlerische Projekte.
Genau. Im Moment berate ich ein Start-up in einer relativ frühen Phase. Das sind die Probleme, die kenne ich, das habe ich alles schon mal gemacht: Investoren finden, Produkt richtig platzieren . . .
Es geht also gar nicht um die technische Seite.
Nein, eigentlich war das auch nie meine Stärke, ich war nie so ein CTO, der die neuesten Technologien unbedingt ausprobieren will. Ich war eigentlich immer mehr in so einer Produktrolle: Was braucht der Markt? Wie übersetze ich das in programmierbare Produkte? Das scheint etwas zu sein, wo man dieses mathematische, also inhaltslose Denken ganz gut gebrauchen kann.
Als was verstehen Sie sich, als Mathematiker, als Unternehmer, als Künstler?
Tja, das weiß ich auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Weil das je nach Phase unterschiedlich ist. Also, von der Art zu arbeiten her verstehe ich mich am ehesten als Mathematiker, weil sie eben nicht inhaltsgetrieben ist, sondern irgendwie formalitätsgetrieben.
Sie meinen die Art undWeise, wie Sie vorgehen.
Genau. Dass ich mir nicht einen Inhalt raussuche und mich an diesem Inhalt abarbeite, sondern jemand kommt mit einem Inhalt und ich versuche das dann zu abstrahieren und die Probleme, die darunter liegen, zu lösen oder umzuformen. Gleichzeitig mach’ ich jetzt auch wieder mehr Musik, und die Arbeit mit den Künstlern ist ja auch irgendwie musikalisch. Ich habe jahrelang in einer Mandolinen-Band gespielt und jetzt spiele ich Gitarre zusammen mit einem von dieser Mandolinen-Band.
Aber das ist Hobby und nicht Beruf.
Stimmt, aber ich weiß es auch nicht so genau. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Rockmusiker werde [lacht].
Ich wollte gerade fragen: Was kommt als nächstes?
Ich weiß es nicht. Als ich aus dem Start-up ausgestiegen bin, hatte das einen gewissen Wert, das heißt, meine Anteile sind auch schon ein bisschen was wert. Ich habe deswegen finanziell nicht mehr den Druck, sofort viel arbeiten zu müssen. Ich kann diese Aktivitäten daher alle so ein bisschen parallel verfolgen, ohne mir überlegen zu müssen, welches davon perspektivisch am meisten Geld abwirft. Also ich weiß es gerade nicht. Vielleicht ziehe ich auch aufs Land und pflanze Kartoffeln [lacht].
Eine letzte Frage: Die Mathematik bietet offenbar in Zeiten von maschinellem Lernen und KI die Möglichkeit, beruflich im Meer der unzähligen Anwendungen hin und her „segeln“, weil sich die Tools alle ähneln. Was meinen Sie, wie bereitet man sich am besten darauf vor?
Ich glaube, man muss wahrscheinlich eine hohe Begeisterungsfähigkeit haben. Gleichzeitig muss ich sagen, das hört sich jetzt so an, als wäre das alles schön und easy gewesen. Aber das war es überhaupt nicht. Jeder Bruch war ziemlich schmerzhaft. Zu realisieren, dass ich nicht in Mathe promovieren will; zu realisieren, dass diese Hirnforscherkarriere nichts für mich ist; zu realisieren, dass ich in dieser Welt mit Künstlern, in der ich der Techniker bin, die Unsicherheit nicht aushalte, das war schmerzhaft. Ein Start-up zu verlassen, in das man fünf Jahre wahnsinnig viel Energie investiert hat, auch das war schmerzhaft. Und ich weiß nicht, ob man sich darauf wirklich gut vorbereiten kann. Wahrscheinlich sollte man sich überlegen, was einem wichtig ist. Wenn einem Sicherheit wichtig ist, dann wird man als Mathematiker auch immer eine sichere Arbeit finden, schätze ich mal. Und wenn man sich wie ich nach einer gewissen Zeit immer langweilt, dann muss man halt damit leben, dass es dann immer schmerzhafte Übergangsphasen gibt.
War Ihre Ausbildung in reiner Mathematik eine gute Basis, um im Beruf diese vielen Wendungen zu nehmen?
Ich weiß es nicht so genau. Der Vorteil an so einem anwendungsfernen Studium ist in gewisser Weise, dass man sowieso weiß, dass man damit keine Stelle bekommt. Es sei denn, ich bin jetzt so begabt, dass ich Professor werde, aber wer ist schon so begabt. Wenn ich dagegen anwendungsnahe Mathematik studiere, dann habe ich immer das Bedürfnis, das ganze Wissen auch anzuwenden. Mir war nach dem Studium schon klar, dass ich mein mathematisches Wissen nie wieder gebrauchen werde. Das hat es einfacher gemacht, mich davon zu verabschieden.
Aber es war eine gute Grundlage?
Ja, weil es eine Art zu denken schult. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass wenn ich anwendungsbezogener studiert hätte, nicht auch ein ähnlicher Muskel trainiert worden wäre. Ich würde aber schon raten, dass man sich, wenn die abstrakte Mathematik Spaß macht, nicht allein aus Karrieregründen dagegen entscheidet. Weil das andere Zeug kann man alles lernen. In einem KI-Lehrbuch, da steht eigentlich nie irgendwas drin, wo ich denke, das verstehe ich nicht. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber mein Gefühl ist, dass es da wirklich keine wahnsinnig komplizierte Mathematik gibt, in dem Sinne wie es die algebraische Geometrie oder die abstrakte Topologie ist. Das heißt, wenn ich das im Studium gelernt habe und ich komme zu einem Arbeitgeber und der sagt, du müsstest dieses Optimierungsverfahren anwenden, dann hat man das in ein paar Monaten irgendwie schon drauf, glaube ich.
Herr Staude, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Das Gespräch führte Kristina Vaillant,
freie Journalistin in Berlin.
www.vaillant-texte.de