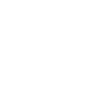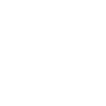Our country, our people, and our laws have to be our top priority.
(Donald Trump in "Crippled America: How to Make America Great Again", 2015)AMS Presidents Kra and Vakil Write to NSF Director
So lautet seit 31. Januar die Headline auf der Webseite der American Mathematical Society. Die AMS-Präsidenten schreiben an den Direktor der National Science Foundation
[...] We are sure that you are inundated with requests and would not write unless it were urgent: we are receiving nonstop requests for help. […] Many postdoctoral fellows have received notification that they will not be paid. They represent the future of US mathematics, and rely on their fellowship stipends for rent and food. […] We understand that the freezes are temporary with reviews underway. However, the immediate impacts will have long-term consequences for American mathematics, research, and development. Most vulnerable are the junior researchers who are now scrambling to ensure their basic needs are met, instead of focusing on basic research.
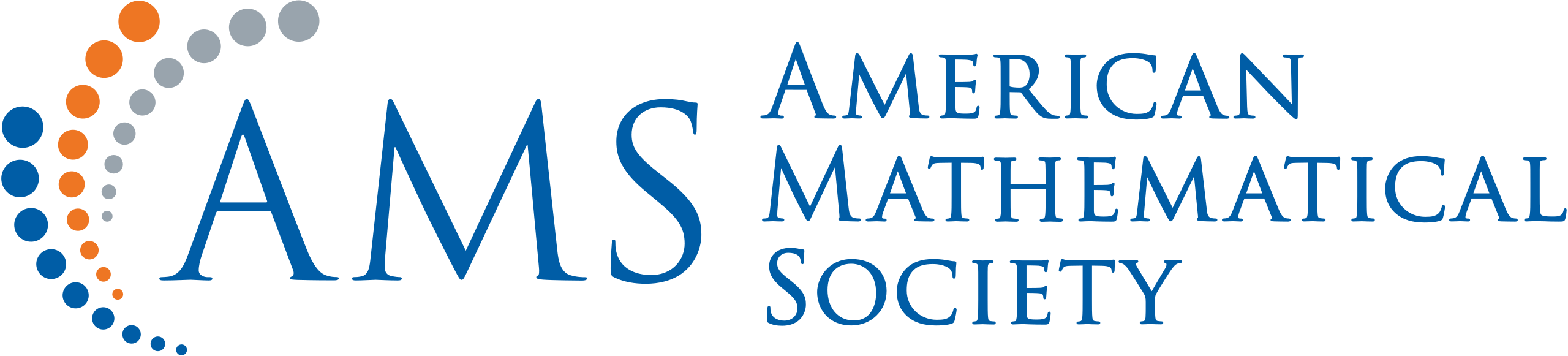
Es geht darum, dass kurz nach Amtsantritt des neuen US-Präsidenten alle Zahlungen der National Science Foundation eingefroren wurden, um zunächst einmal alle geförderten Projekte daraufhin zu überprüfen, ob sie der neuen politischen Linie entsprechen. Nach einem Bericht der Washington Post sollten dabei insbesondere Projekte geprüft werden, deren Förderanträge Begriffe wie "Frauen", "Vielfältig“, "Institutionell“, "Trauma“ oder "Barrieren“ enthielten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (10. Februar) ist nicht klar, wie die Sache ausgeht. Sicherlich kann man davon ausgehen, dass die Überprüfung in absehbarer Zeit abgeschlossen sein wird und Projekte aus der Mathematik kaum betroffen sein werden. Und mancher wird sich vielleicht heimlich freuen, wenn seinen Kollegen nun Buzzworte in Förderanträgen auf die Füße fallen, die ja eigentlich nur aus politischen Gründen im Antrag erschienen und mit den geförderten Projekten meist wenig zu tun hatten.
Das eigentlich Irritierende an der ganzen Angelegenheit ist, wie wenig Widerstand es gegen diese Maßnahmen gibt (auch der Brief der AMS-Präsidenten richtet sich ja nur gegen das Einfrieren der Zahlungen) und wie willfährig die Mitarbeiter der National Science Foundation alte Anträge jetzt nach ebenjenen Begriffen durchsuchen, die sie bisher als ein Plus für einen Förderentscheid angesehen hatten und die in die Anträge einzubauen sie den Bewerbern ja wahrscheinlich sogar empfohlen hatten.
Vor acht Jahren
Nach Trumps erstem Amtsantritt 2017 hatte es sehr viel deutlichere Reaktionen auch aus der mathematischen Community gegeben. Insbesondere die seinerzeit verhängte "Executive Order on Immigration" hatte damals heftige Reaktionen ausgelöst und war nach kurzer Zeit zurückgenommen worden.
Terence Tao, der wohl mit Abstand meistgelesene Mathematik-Blogger, begann am 31. Januar 2017 (auf den Tag acht Jahre vor dem Brief der beiden AMS-Präsidenten) seinen Artikel "Open thread for mathematicians on the immigration executive order" mit der folgenden Klarstellung:
The self-chosen remit of my blog is “Updates on my research and expository papers, discussion of open problems, and other maths-related topics”. Of the 774 posts on this blog, I estimate that about 99 percent of the posts indeed relate to mathematics, mathematicians, or the administration of this mathematical blog, and only about 1 percent are not related to mathematics or the community of mathematicians in any significant fashion.
This is not one of the 1 percent.
Mathematical research is clearly an international activity. But actually a stronger claim is true: mathematical research is a transnational activity, in that the specific nationality of individual members of a research team or research community are (or should be) of no appreciable significance for the purpose of advancing mathematics.
Das damals zum Beispiel für Bürger des Iran verhängte Einreiseverbot, hätte es Bestand gehabt, hätte offensichtliche Auswirkungen auf die mathematische Forschung gehabt und das nicht nur, weil der Iran ein Land mit vielen sehr gut ausgebildeten Studenten ist, von denen viele eine Tätigkeit in den USA attraktiver finden als in ihrem Heimatland. Selbst das zurückgenommene Einreiseverbot dürfte Auswirkungen gehabt haben auf die Atmosphäre an Universitäten und Forschungseinrichtungen, es wird dort diejenigen ermutigt haben, die ohnehin schon immer der Meinung waren, man solle Stellen lieber mit eigenen Leuten besetzen als mit Forschern aus anderen Kulturkreisen. (Wie es etwa nach den Anschlägen vom 11. September der Fall war. Man hörte damals von Bewerbern beispielsweise aus dem Iran an US-Universitäten, denen nahegelegt wurde, ihre Bewerbung wegen der möglichen Visaprobleme doch besser gleich von sich aus zurückzuziehen und sich lieber in anderen Ländern zu bewerben. Ein Einreiseverbot gab es auch damals nicht, aber die sich so zeigende veränderte Atmosphäre wird sicher manchen dann trotzdem davon abgehalten haben, in die USA zu gehen.)
Die Immigration Order war damals Thema zahlreicher mathematischer Blogs und Initiativen:
-https://www.scottaaronson.com/blog/?p=3167 ("First they came for the Iranians", Scott Aaronson),
-https://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=9076 ("Fascism and the Current National Emergency", Peter Woit),
-https://www.youtube.com/watch?v=fV9ajE8c4TI ("What Worries Me Most", Leonard Susskind),
-https://www.math.toronto.edu/~rafi/statement/index.html ("Statement of Inclusiveness", Juan Souto, Kasra Rafi et al.)
und die Petition https://notoimmigrationban.com/ ("Academics Against Immigration Executive Order").
Eine in diesen Zusammenhang passende Geschichte um den Verlag Taylor and Francis löste im Dezember 2018 einige Aufregung unter Mathematikern aus. Die von dem Teheraner Professor Abbas Fakhari mit seinem in Brasilien arbeitenden Landsmann Mohammad Soufi geschriebene Arbeit "Saturation of generalized partially hyperbolic attractors" war nach zwei Jahren Begutachtung bei "Dynamical Systems" angenommen und dort auch bereits auf der Webseite online publiziert worden. Am 7. Dezember erhielt Fakhari dann diese Mitteilung des Verlages:
As a result of our compliance with laws and regulations applied by the UK, US, European Union, and United Nations jurisdictions with respect to countries subject to trade restrictions, it is not possible for us to publish any manuscript authored by researchers based in a country subject to sanction (in this case Iran) in certain cases where restrictions are applied. Following internal sanctions process checks the above referenced manuscript has been identified as falling into this category. Therefore, due to mandatory compliance and regulation instructions, we regret that we unable to proceed with the processing of your paper.
Die Entscheidung paßte wohl in einen allgemeinen Trend, dass iranischstämmige Wissenschaftler bei manchen Konferenzen nicht mehr eingeladen und bei manchen Stipendienentscheidungen benachteiligt werden sollten. Glücklicherweise blieb das Herausgebergremium hart und schickte zwei Tage später einen geharnischten Beschwerdebrief an den Verlag. Innerhalb weniger Stunden zog dann Taylor and Francis seine Entscheidung zurück.
Und heute
Heute hat man - jedenfalls aus der Entfernung - den Eindruck, dass es kaum noch Widerstand gegen die aktuellen Entwicklungen gibt. Sicher gibt es Gerichte, die gegen administrative Maßnahmen entschieden, und natürlich gibt es auch noch die 50 Bundesländer, die Entscheidungen unabhängig von der Zentralregierung treffen können und vielleicht am ehesten Hoffnung geben, dass das System der "Checks and Balances" auch weiter funktionieren könnte.
Natürlich sind historische Vergleiche immer schwierig und insbesondere Vergleiche mit der deutschen Geschichte meist nicht hilfreich. Trotzdem sollte man im Kopf behalten, wie der Übergang zur Diktatur im Deutschland des Jahres 1933 ablief.
Einen Eindruck von den Entwicklungen im März des Jahres 1933 erhält man beim Lesen der von Constance Reid verfassten Biographie Richard Courants, des seinerzeitigen (seit 1922) Direktors des Mathematischen Instituts in Göttingen.
Anfang März 1933 traf Courant Vorkehrungen, daß Friedrichs und Franz Rellich ihn und seine Familie während der Frühlingsferien nach Arosa begleiten sollten. Dort wollten sie skifahren und arbeiten und den zweiten Band des Courant-Hilbert abschließen.
Courant kannte die Gerüchte, nach denen er vorhatte, sich in die Schweiz abzusetzen. Er erwog daher, die Ski- und Arbeitsferien abzusagen, "weil es mir natürlich in einem solchen Moment unsympathisch schien, ruhig und friedlich im Ausland zu sitzen“ erklärte er Franck. Aber seine Kinder brauchten die Sonne und die frische Bergluft; Friedrichs und Rellich erwarteten ihn bereits in Arosa, und so entschloß er sich, bei seinen Reiseplänen zu bleiben.
Die Folge der Ereignisse, die Empfindungen und Argumente, welche die Handlungsweise Courants und vieler anderer in den nächsten Monaten bestimmten, sind in den darauf folgenden Jahren oft verblasst; was man damals schon wußte, vermischte sich mit dem, was erst später bekannt wurde; was hätte geschehen sollen mit dem, was wirklich war. Aus diesem Grund habe ich versucht, meinen Bericht auf jene Dokumente zu beschränken, die Courant 1934 mit in die Vereinigten Staaten brachte, und die er mir 1971, wenige Monate vor seinem Tod, zur Verfügung stellte. Er brachte es nicht fertig, sie im Einzelnen noch einmal durchzugehen, sondern warf nur einen flüchtigen Blick hinein und bemerkte, das es ihm fast unmöglich sei zu glauben, das er das, was da stand, tatsächlich geschrieben habe.
Während Courant in Arosa war, setzte Hitler das Ermächtigungsgesetz durch, das der Regierung die Vollmacht gab, unabhängig vom Reichstag und vom Reichspräsidenten Verordnungen zu erlassen. Für den 1. Aprilwurde ein landesweiter Boykott jüdischer Unternehmen und Geschäfte angekündigt.
Am 30. März schrieb Courant an Franck und fragte ihn, ob er sofort nach Göttingen zurückkehren sollte. Er war überzeugt davon, daß es ihm gelingen würde, den zweiten Band des Courant-Hilbert wenigstens bis zur Hälfte abzuschließen, falls er, wie geplant, in Arosa bleiben könne. Was ihn jedoch beunruhigte, war, daß er am Vortage durch die Dienstboten erfahren hatte, daß in Göttingen das Gerücht umging, er werde nicht zurückkehren.
"Im übrigen hatte ich aus den Zeitungsnachrichten den Eindruck, daß doch bis jetzt in Deutschland alles verhältnismäßig friedlich und ruhig vor sich gegangen war“, schrieb er an Franck, "und ich war vom ersten Augenblicke an entsetzt darüber, in welcher Art - Zeitungsnachrichten zufolge - Leute wie Einstein sich äußerten und auch sonst die inneren Verhältnisse bei uns mit Lügen und Latrinenparolen zum Anlaß einer allgemeinen politischen Agitation gegen Deutschland im Ausland mißbraucht wurden. Wenn ich Einsteins Adresse gekannt hätte, würde ich ihm geschrieben haben ...“
Einstein, der seit ein paar Monaten in Amerika war, hatte einige stark beachtete Erklärungen abgegeben, in denen er "die brutalen Gewaltakte und die Unterdrückung liberal denkender Personen und der Juden in Deutschland“ bedauerte, "die das Gewissen aller Länder, die den Idealen der Menschlichkeit und der politischen Freiheit treu geblieben sind, aufgeschreckt haben.“ Er hoffe, daß die weltweite Empörung stark genug sein werde, "Europa vor einem Rückfall in die Barbarei vergangener Epochen zu bewahren“. Am 29. März, einen Tag bevor Courant seinen Brief an Franck verfasste, hatte die Regierung in Berlin bekanntgegeben, daß Einstein Schritte unternommen habe, um auf seine preußische Staatsangehörigkeit zu verzichten.
"Wenn sich Einstein nicht als Deutscher fühlt“, fuhr Courant fort, "so hat er doch so viel Gutes in Deutschland erfahren, daß er zum mindesten die Pflicht hätte, die von ihm gestiftete Unruhe wieder nach Kräften gut zu machen. Leider ist, wie ich eben in den Zeitungen lese, die Reaktion auf diese Dinge in Deutschland nicht ausgeblieben. Wie immer in der Welt wird der Gegenschlag in erster Linie Unschuldige und Harmlose treffen. Ich hoffe sehr, daß es gelingen wird, die Boykottbewegung [gegen die Juden] noch im letzten Augenblick abzuwenden oder wenigstens bald zu beendigen. Sonst sehe ich sehr schwarz.
Was mich besonders kränkt und bekümmert ist, daß der jetzt wieder in Bewegung geratene Anti-semitismus sich nicht nur gegen unsympathische literarische und sonstige Zersetzungserscheinungen richtet, die ich und Du ebenso und vielleicht mehr verurteilen als mancher "völkische“ Mann, sondern unterschiedslos gegen jeden Menschen jüdischer Abstammung, mag er innerlich ein noch so guter Deutscher sein, mag er und seine Familie im Kriege geblutet haben oder sonst sein Bestes für die Gesamtheit leisten. Ich kann auch nicht glauben, daß auf die Dauer eine solche ungerechte Einstellung bestehen bleiben wird; wenigstens nicht, soweit es sich um die Führer, insbesondere Hitler handelt, dessen letzte Reden mir persönlich durchaus einen positiven Eindruck machten.“
(C. Reid: „Richard Courant: 1888-1972. Der Mathematiker als Zeitgenosse.“ Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag 1979)
Courant brauchte dann übrigens nur wenige Wochen, um seinen Irrtum einzusehen.
Zusammenbrüche
Das Mathematische Institut in Göttingen galt seit Gauss' Zeiten als das Weltzentrum der Mathematik und ging dieser Position dann 1933 innerhalb kurzer Zeit verloren. Bemerkenswerterweise nicht nur durch die Vertreibung der jüdischen Mathematiker, sondern weil auch eine Reihe eigentlich nicht betroffener deutscher Mathematiker in diesem gleichgeschalteten Institut dann nicht mehr arbeiten wollten.
Institutions are fragile. They are easier to destroy than build. A few months of Hitler’s policies unraveled two centuries of mathematical progress in Göttingen. That university, and Germany more broadly, never fully recovered. As von Neumann correctly predicted in 1933, “If these boys continue for only two more years (which is unfortunately very probable) they will ruin German science for a generation — at least.” (aus einem 2017 veröffentlichten Artikel von Evelyn Lamb auf "undark")
Profitiert hatte damals vor allem Princeton, das europäischen Immigranten aufgeschlossener gegenüberstand als viele andere amerikanische Universitäten (Harvard unter Birkhoff zum Beispiel war eurpäischen Immigranten gegenüber sehr negativ eingestellt) und in der Folge die Rolle Götingens als mathematisches Zentrum übernahm.
Als anderes Beispiel für den Niedergang eines Instituts bietet sich Moskau an, das in den 50er bis 70er Jahren als vielleicht der Ort auf der Welt mit der meisten mathematischen Aktivität galt, wo dann aber ab Mitte der 70er Jahre (innerhalb der Mathematik, nach außen vor allem verbunden mit der Rolle Pontrjagins) versucht wurde, jüdische Wissenschaftler und Studenten aus den Universitäten fernzuhalten. Profitiert haben auch damals vor allem die USA und in geringerem Maße die europäischen Länder.
Und ein weiteres, aktuelleres Beispiel, wäre die Schließung der Central European University in Budapest, die unter anderem auch ein Mathematik-Department mit 14 renommierten Professoren hatte. Es ist bemerkenswert, dass damals (2017) schon die Wissenschaft an sich (und ihre internationale Vernetzung) als Bedrohung für den "illiberalen Staat" angesehen wurde. In einer Pressekonferenz sprach der ehemalige Bildungsminister Péter Harrach von den Professoren der CEU als "Offizieren einer Okkupationsarmee“. (Die Universität zog dann nach Wien um, hat dort aber kaum noch Mathematik.)
Chancen für Deutschland?
Im SPIEGEL 7/2025 meldet Patrick Cramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, viel mehr Bewerbungen aus den USA als früher und sieht Deutschland als möglichen Nutznießer von Trumps Feldzug gegen die Wissenschaft: "Auf die jüngste Ausschreibung für die Leitung von Forschungsgruppen haben wir doppelt so viele Bewerbungen aus den USA erhalten wie im vorangegangenen Jahr. Mit Blick darauf sind die USA für uns ein neuer Talentpool. Mit zusätzlichen Mitteln werden wir versuchen, weitere Gruppenleiterstellen zu schaffen, um diesen Menschen eine Perspektive zu bieten und zugleich die Max-Planck-Gesellschaft zu stärken."