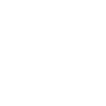„Erst denken, dann rechnen!“ „Weniger Kalkül, mehr Prozess!“ So oder ähnlich klingen viele Postulate an den heutigen Mathematikunterricht. Auch der kleine Carl Friedrich Gauß muss – wohl eher unbewusst – davon Gebrauch gemacht haben, als er schon in der Grundschule die Summe der Zahlen von 1 bis 100 in Sekunden berechnete.
In der Bewertung dieser Anekdote hinsichtlich der Bedeutung des Rechnens wird aber gern übersehen, dass der kleine Carl Friedrich offensichtlich bereits sehr viel über das Rechnen wusste, als er die Aufgabe genial löste. Er muss die Gültigkeit von Assoziativ- und Kommutativgesetz mindestens unterschwellig anerkannt haben und geahnt haben, dass darin Möglichkeiten zur Rechenvereinfachung liegen. Auch hatte er offensichtlich begriffen, dass die Multiplikation auf die Addition zurück geführt werden kann, nämlich wenn lauter gleiche Summanden zu addieren sind.
Woher wusste er all dies? Natürlich, weil er bereits einige Übung im Rechnen hatte. Wer erst denken und dann rechnen möchte, muss über das, was da zu rechnen wäre, bereits vor dem Denken sehr gut Bescheid wissen. Und dieses Wissen wird vor allem durch den expliziten Umgang mit dem Rechnen, durch die Rechenübungen erworben. Es wird oft nicht klar genug unterschieden zwischen der Rolle des Rechnens im Zuge einer Problemlösung und der Rolle des Rechnen-Lernens im Rahmen des Mathematik-Lernens.
Das Rechnen-Lernen ist zunächst einmal aus zwei Gründen erforderlich: zum einen, weil das Wissen über das Rechnen das Nachdenken über eine Problemlösung unterstützt (siehe Carl-Friedrich) und zum zweiten, weil das Rechnen-Lernen als Miniaturausgabe des Mathematik-Lernens propädeutische Funktion hat. Wichtige heuristische Prinzipien und Strategien werden bereits im Rahmen des Rechnen-Lernens erfahren und geübt. Abstraktionen und damit erste Ansätze zu Begriffsbildungen finden auch schon im Rahmen des Rechnen-Lernens statt - ja, sie sind hier sogar unerlässlich.
Die unzureichende Differenzierung der Rolle des Rechnens im Problemlösen und im Mathematik-Lernen hat dazu geführt, das der Taschenrechner im heutigen Mathematikunterricht eine verfehlte Rolle zugewiesen bekommt. Den Schüler*innen wird vermittelt, dass nicht Rechnen, sondern Denken wichtig sei, dass man das Rechnen besser Maschinen überlässt. Und die Schüler*innen nehmen diesen Hinweis dankbar auf. Sie rechnen nun auf Teufel-komm-raus alles aus, was ihnen in die Quere kommt. Ein Beispiel: Das Integral als Flächeninhalt soll über Ober- und Untersummen eingeführt werden. Der Lehrer wählt zunächst ein Zahlenbeispiel, bei dem 10 Rechtecksflächen zu addieren sind. Die meisten Schüler*innen rechnen sofort jede einzelne Rechtecksfläche auf drei Stellen hinter dem Komma genau aus. Damit wird der Zugang zu Rechenvereinfachungen und zu Term-Struktur-Erkennungen vollständig verbaut.
Der Lehrer täte also gut daran, entweder den Rechnereinsatz zu verbieten oder von Anfang an auf ein Zahlen-beispiel zu verzichten und Rechtecksflächen über dem Intervall [0,a] addieren zu lassen. Leider scheitert dann der Stundenfortschritt, weil nun Tugenden gefordert sind, die der kleine Gauß von sich aus zu bieten hatte, über die Schüler*innen im allgemeinen heute aber nicht mehr verfügen: Rechengesetze müssen als gültig und vereinfachend gekannt werden (hier das Distributivgesetz) und die Summenbildung in der Klammer muss den Verdacht auslösen, dass auch sie vereinfacht werden könnte (Blick in die Formelsammlung).
50% der Studienanfänger*innen in Mathematik können keine Bruchrechnung. Der Prozentsatz unter denen, die nicht Mathematik als Studienfach wählen, ist bedeutend größer. Warum ist das so?
Weil die Rolle des Kalküls im Zusammenhang mit „Mathematik-Machen“ diffamiert wurde.
Die Formulierung: „Weg vom Kalkül – hin zum Prozess“ geht von der Prämisse aus, dass Kalkül und Prozess zwei deutlich voneinander getrennte Orte seien. Dies ist aber nicht der Fall. Denn erstens enthält jeder Prozess den Kalkül als Baustein (siehe Gauß) und zweitens steckt selbst im Kalkül auch ein Stück Prozess. Die Multiplikation beschreibt den Prozess der Addition gleicher Summanden und die Potenz steht für die Multiplikation gleicher Faktoren. Wie komplex muss eigentlich ein Prozess werden, damit er nicht mehr Kalkül genannt werden kann? Diese Frage lässt sich wohl kaum beantworten. Ein Kalkül mit einem komplexen Hintergrund wird von unserem Gehirn zu einem Superzeichen umgebaut. Über diese Fähigkeit des Gehirns zur Selbstorganisation macht man sich immer noch zu wenig Gedanken, wenn man den Kalkül nicht als Teil des Prozesses würdigt.
Viel zu selten wird der Taschenrechnergebrauch aus der Sicht der Neurophysiologie betrachtet. Hier stellen sich die Dinge so dar: Die cerebrale Entwicklung besteht in der zunehmenden Komplexität der Verschaltung der Neuronen untereinander, der sogenannten Modulation. Welche Verschaltungen sich verfestigen und welche nicht, hängt davon ab, inwieweit sie sich im Wettbewerb um Kontrolle und Steuerung des Verhaltens erfolgreich durchzusetzen vermögen nach dem "survival of the fittest"-Prinzip, das die Selbstorganisation reguliert. In Situationen, in denen sich ein bestimmtes Modul wiederholt erfolgreich durchgesetzt und das Verhalten dominiert hat, ist dieses entsprechende Modul außer Konkurrenz und wird so wieder und wieder verstärkt und immer "mächtiger".
Für den Gebrauch eines elektronischen Hilfsmittels im Zusammenhang mit problemlösendem Verhalten bedeutet dies: Wenn eine bestimmte Tastenkombination erfolgreich zur Problemlösung beiträgt, wird die für die Erinnerung an diese Tastenkombination erforderliche Verschaltung im Gehirn mächtiger als alle händischen oder im Kopf durchführbaren Verfahren. So lässt sich auch erklären, dass Schüler*innen für höchst simple Multiplikations-aufgaben (¾∙4 oder 0,3∙10) den Taschenrechner einsetzen und nicht auf Muster im Gehirn zurück greifen, (die dort möglicherweise auch gar nicht angelegt sind). Die Frage, wie sich ein derartiger TR-Einsatz auf das Erlernen von Mathematik auswirkt, darf nicht unbeantwortet bleiben. Die Befürworter*innen des Einsatzes elektronischer Werkzeuge im Mathematikunterricht wissen durchaus, dass ein völliger Verzicht auf händische oder im Kopf ablaufende Rechen- und Termumformungsprozesse nicht vertretbar sein kann. Sie reagieren darauf mit „Black-box-white-box“-Methoden und der Angabe von „Minimalkatalogen“. Aus neurophysiologischer Sicht darf die Wirkung solcher Maßnahmen aber bezweifelt werden. Sie stellen zwar die Konkurrenz zwischen elektronischen und nicht-elektronischen Hilfsmitteln deutlich heraus, fragen aber nicht, wer diese Konkurrenz auf Dauer gewinnt.
Und noch etwas: bei der Herausbildung von Dominanzen in der neuronalen Verschaltung ist ein „Driften“ möglich und diese Metapher des Driftens lässt sich auf Lehr-Lernprozesse übertragen. „In der Driftzone entsteht ein breites Feld von subjektiv konstruiertem Wissen. Diese Wissenskonstruktionen sind sehr unterschiedlich, denn mensch-liche Erkenntnis ist nicht nur kulturabhängig, sondern auch im Laufe der individuellen, familiären und schulischen Entwicklung qualitativen Änderungen unterworfen“. Wenn also bis zum 6. Schuljahr ohne Elektronik, dann aber verstärkt mit Elektronik gearbeitet wird, können erlernte Fähigkeiten und Verfahren wieder verblassen (siehe oben: 50% der Studienanfänger*innen in Mathematik können keine Bruchrechnung).
Kognitives Lernen ist vor allem ein Erkennen von Mustern; die neuronalen Netze sind in der Lage, zu abstrahieren und zu generalisieren. Andererseits lernt das Gehirn keine abstrakten Regeln, sondern Fälle, Beispiele. „Das Gehirn braucht nicht Regeln, sondern gute Beispiele. Um Regeln aus Inputbeispielen abstrahieren zu können, muss der Input diese Regeln widerspiegeln, d. h. er bedarf einer inneren Struktur Es wird besser gelernt, wenn zunächst einfache, aber grundlegende Beispiele trainiert werden“. Solche einfachen aber grundlegenden Beispiele beherrschten früher den Mathematikunterricht. Heute gilt dieses Vorgehen als kalküllastig und wird deshalb abgelehnt.
Die heutige Didaktik hat sich nahezu vollständig von ihren der Semiotik zugehörigen Ansätzen entfernt. Die Bedeutung der Mathematik für die Allgemeinbildung liegt nach Auffassung der Semiotik gerade darin, dass Kinder anhand der Mathematik, des ersten Darstellungssystems, mit dem sie neben ihrer Muttersprache vertraut werden, die Entwicklung von Darstellungsmöglichkeiten, wie sie für jede Wissensbildung als entscheidend angesehen werden kann, gleichsam spielerisch kennen lernen. So kann Kindern deutlich werden, dass die abstrakten Zeichen der Mathematik bestimmte Dinge viel einfacher darzustellen erlauben und leichter handhabbar machen, und dass "Lernen" im Grunde nichts anderes ist, als immer wieder neue Mittel zu gewinnen, um immer mehr immer übersichtlicher darzustellen.
Eine wichtige Form der Entwicklung von Darstellungsmöglichkeiten, die schon beim Lernen von Schulanfänger-*innen (aber nicht nur bei diesen) von Bedeutung ist, besteht also im Prozess der Bildung mathematischer Begriffe. Man nennt das auch den Prozess der hypostatischen Abstraktion. Eine hypostatische Abstraktion ist derjenige "Prozess, durch den wir einen Gedanken als ein Ding auffassen“: der Gedanke „diese Menge besteht aus 5 Objekten“ wird durch das Zahlzeichen 5 ersetzt. Die so gewonnenen Zahlzeichen werden in nahe liegender Weise miteinander verknüpft und es entstehen neue Zeichen für die Verknüpfungen. Die Verknüpfungen zeigen charakteristische Strukturen, die in Gesetze gefasst werden und so weiter und so weiter. All dies erlebt man ohne Computer viel intensiver als mit ihm.
Jedes Nomen unserer Sprache ist das Ergebnis einer hypostatischen Abstraktion, mit der irgendwann in unserer Kulturgeschichte etwas "auf einen Begriff gebracht" wurde, wie man auch sagt. Bereits unsere Zahlworte sind Zeichen für "abstrahierende Vergegenständlichungen". Abstrakte Wissenschaften wie die Mathematik sind ohne hypostatische Abstraktionen überhaupt nicht denkbar. Die wesentliche Bedeutung des Begriffes der "hypostatischen Abstraktion" kann darin gesehen werden, dass mit ihm beschrieben werden kann, wie immer neue Mittel für weitergehende Verallgemeinerungsprozesse geschaffen werden.
Besser als in allen anderen Schulfächern kann exemplarisch in der Mathematik die Entwicklung der Erkenntnis als Verallgemeinerungsprozess vom Schüler oder von der Schülerin erlebt werden, der in der Einführung idealer Gegenstände der kognitiven Tätigkeit vermöge hypostatischer Abstraktionen auf stets höherer Stufe besteht. Das Wesentliche am Prozess der hypostasierten Abstraktion ist die Rekursivität des Denkens, die darin zum Ausdruck kommt, dass ein Gedanke oder eine Handlung zum Gegenstand eines anderen Gedankens wird. Die unendliche Rekursivität des Abstraktionsprozesses ist ein Merkmal der Mathematik der Moderne und ein überaus wichtiger Aspekt des Mathematikunterrichts.
Wer diesen Aspekt mit in die Diskussion um „Computer und Mathematikunterricht“ einbezieht, wird sich fragen: „Welche fruchtbare Neugier kann das zu schnell zugängliche Bild zerstören, welche notwendigen Aktivitäten verhindert es?“ Und dann: „Unterbricht nicht das zu schnell zugängliche Bild oder Ergebnis die Rekursionskette der hypostatischen Abstraktion und verhindert so kognitive Tätigkeiten vermöge hypostatischer Abstraktionen?“